Alkohol ist seit geraumer Zeit nicht allein durch Gastronomie und Sponsoring wichtig für die Szene. Im zweiten Teil unserer großen Recherche zur Verbindung von Alkoholindustrie und Clubkultur nehmen wir in den Blick, wie sich Brands durch kulturelles Marketing in die Infrastrukturen einer Subkultur eingekauft haben.
Auch interessant

Alkohol ist der finanzielle Treibstoff eines jeden Clubs. "Eintrittspreise machen 20 bis 40 Prozent des Umsatzes aus, der Rest wird an der Bar eingenommen", erklärte Marcel Weber von der Berliner Clubcommission im ersten Teil unserer Reportage. Von den 60 bis 80 Prozent der Einnahmen wiederum wird das Gros mit Bier und Schnaps umgesetzt. Obwohl sich dieses Verhältnis erst mit der zunehmenden Professionalisierung der Szene etablierte und einige der frühen Clubs der Disco- und House-Ära weitgehend oder komplett auf den Ausschank von alkoholischen Getränken verzichteten, spielte die Clubkultur aus der anderen Perspektive heraus betrachtet schon früh eine Rolle für die Alkoholbranche – nicht allein, weil sich ihre Produkte dort verkaufen ließen. Sondern auch, weil sie dort werben konnte.
In seinem Buch über die Verwicklungen zwischen Werbebranche und Clubkultur schreibt Andy Crysell zum Beispiel darüber, wie Absolut in den 1970er-Jahren das damalige It-Girl Christina "Titti" Wachtmeister als eine Art Proto-Influencerin mit den markanten Wodkaflaschen durch New York schickte – inklusive des größten Disco-Clubs dieser Zeit, dem Studio54. Mehr noch ist in Selling the Night. When Club Culture Meets Brands, Advertising and the Creative Industries zu lesen, dass Absolut-Geschäftsführer Michel Roux die queere Community der Stadt, die vor allem in den Clubs zu finden war, als Tastemaker:innen für sich auserkor und gezielt versuchte, sie von ihrem Produkt zu überzeugen. Damit wirbt die mittlerweile zu Pernod Ricard gehörende Marke weiterhin.

Marketing-Strategien wie die von Absolut blieben allerdings für lange Zeit die Ausnahme in die Branche. Alkoholmarken fokussierten sich vornehmlich darauf, am point of sales ihre Produkte zu bewerben. Dazu gehörten in erster Linie Festivals und tatsächlich zählen die Loveparade und die MayDay zu den ersten von Großunternehmen gesponserten Veranstaltungen der frühen Techno-Ära im deutschen Raum, bei denen auch Alkoholmarken eine Rolle spielten. Zusätzlich dazu konzentrierten sich viele Brands lange auf andere musikalische Subkulturen. Wer sich mit Rave-Veteran:innen über das Thema unterhält, wird zum Beispiel erfahren, dass ein bestimmter, in der deutschen Stadt Wolfenbüttel hergestellter Kräuterschnaps ab Ende der 1980er-Jahre fest zum Inventar jeder After-Hour gehörte.
Doch Jägermeister entdeckte erst im Laufe der 2010er-Jahre seine vermeintliche Liebe zur Clubkultur, nachdem das Unternehmen lange Zeit vor allem im Rock- und Metal-Bereich für sich geworben hatte. Damit verschlief es den ersten großen Hype und die erste tiefschürfende Annäherung von Rave-Kultur und den verschiedensten Branchen. Denn als der große Freudentaumel der Nachwendezeit auf die Dancefloors im wiedervereinten Berlin, in Kassel, Bad Klosterlausnitz oder Mannheim drängte, um dort die Rave-o-lution einzuläuten, wollten sehr viele Unternehmen nicht von der Seitenlinie zuschauen. Sie sahen die Möglichkeit, sich neue Absatzmärkte im direkten Handgemenge zu erschließen. Ihre Methoden waren so neu wie die Musik, die währenddessen im Hintergrund lief.
Die 1990er-Jahre: Werbung unter der Gürtellinie
Die Markenwelt näherte sich erstmals der internationalen Clubszene an, als diese Anfang und Mitte der 1990er-Jahren ihre ersten Mainstream-Erfolge erlebte. Das lag nicht allein daran, dass der Erfolg dieser Kultur ihnen Zugriff zu einem jungen und spendierfreudigen Publikum versprach. Auch äußere Zwänge und ein Paradigmenwechsel in den gängigen Werbestrategien spielten in diese Entwicklung rein. Wer die Erzählungen aus den frühen 1990er-Jahren kennt, wird um die Marketing-Bemühungen von Tabakkonzernen wie Philip Morris oder der Marke Camel wissen. Letztere veranstaltete in den Jahren 1994 und 1995 unter anderem die von der Agentur Megacult erdachten Airaves – Flugreisen mit einer geladenen Crowd von Party People, die beispielsweise auf dem Weg nach Kreta hunderte Meter in der Luft zu Sets von Jeff Mills tanzten.
Dass Tabakunternehmen in der Szene aktiv wurden, hatte rechtliche Gründe. "Der Staat hatte Zigaretten [...] bei herkömmlichen Werbemethoden drastisch beschnitten", erinnerte sich Hans Nieswandt 2002 in seinen DJ-Memoiren plus minus acht. "TV-Spots und Plakate, auf denen attraktive Menschen genussvoll Kippen smoken, waren verboten worden. [...] Andere, modernere und subtilere Werbemaßnahmen mussten her." Deshalb fand Werbung zunehmend "below the line" statt. Der Begriff spricht bereits aus, dass diese Form des Marketings unter der Wahrnehmungsgrenze stattfinden sollte. Das Ziel, so formulierte es ein SPIEGEL-Artikel aus dem Jahr 1992, lag darin, "das Markenzeichen wie ein Brandzeichen im Gehirn zu verewigen". Nicht mehr ging es um das Produkt allein, sondern die dahinterstehende Firma.

Je mehr sich der Traum der "ravenden Gesellschaft" erfüllte, desto interessanter wurde Clubkultur für Markenartikler, die im öffentlichen Bewusstsein eine Verbindung ihrer Brand mit einem Lifestyle herstellen wollten. Deshalb ist auch von "kulturellem Marketing" die Rede. Die Methoden waren unterschiedlich. Marlboro-Hersteller Philip Morris etwa setzte Compost-Gründer Michael Reinboth als "Minister for Music and Nightlife" ein und sponserte eine – scharf kritisierte – Tresor-Tournee. Asmussen Rum entwickelte ein Getränk mit Guarana namens Starkstrom, laut taz "vermutlich als eine Art Flachmann für die Techno-Szene gedacht", zu dem natürlich ein eigener Soundtrack gehörte. Selbst bei der Loveparade kreuzte ein "Bud Ice Truck" auf. Dergleichen Beispiele finden sich viele.
Einige Below-the-line-Kampagnen fanden eher unter der Gürtellinie statt und wirken aus heutiger Sicht mindestens hochnotpeinlich bis komplett bizarr. Zum einen mag das schlicht daran liegen, dass sie die geistigen Kinder eines grell übersteuerten Jahrzehnts waren. Zum anderen sieht Marketing im Clubkontext heute ungleich subtiler aus und versucht neben knalliger Eventisierung viel umfangreicher zu wirken. Das wiederum ist der maßgebliche Verdienst eines Unternehmens, dessen zentrales Produkt zwar keinen Alkohol enthält, im Club jedoch nur selten ohne hochprozentige Beimischung konsumiert wird: Die Red Bull Music Academy stieß in ihrer 21-jährigen Schaffensphase einen neuerlichen Paradigmenwechsel an.
Energy Flash: Red Bull und die Folgen
Als die Red Bull Music Academy im Jahr 1998 von der Agentur Yadastar aus der Taufe gehoben wurde, geschah dies unter veränderten Vorzeichen. Hatte die maßgebliche, durch die Arbeit von Megacult geprägte Below-the-line-Markenwerbung in der Mitte des Jahrzehnts noch auf aufsehenerregende Spektakel wie die Airaves gesetzt, gestaltete sich der Ansatz der RBMA weitaus weniger reißerisch. Das war der neuen Ära angemessen, denn ein kritischer historischer Wendepunkt in der Geschichte von Clubkultur und Musikindustrie zeichnete sich ab. Der große Techno-Hype flaute rasend schnell ab und der Markt verkleinerte sich, während die vorher noch mit 56k-Modem laufende Digitalisierung begann, die Musikwelt mit DSL-Geschwindigkeit vor neue Herausforderungen zu stellen.
Die RBMA bot in diesen unsicheren, unsteten Zeiten aufstrebenden Produzent:innen und DJs mit ihren schon bald international ausgerichteten Workshops und Showcases sowohl Starthilfe als auch gelegentliche Einnahmen an. Abgerundet wurde dies von quasi-journalistischen Formaten in Form der sogenannten Lectures – kaum mehr als extensive Interviews mit legendären Figuren der weltweiten Szene. Für die Firma Red Bull und die RBMA präsentierte sich all das als Win-win-Situation: Der Energydrink-Hersteller konnte mit vergleichsweise moderaten finanziellen Mitteln sein Image in einer ganzen Subkultur aufpolieren und die RBMA der Szene mit Mitteln unter die Arme greifen, die das normalerweise verfügbare Kapital einer prekär arbeitenden Branche weit überschritten.

Das Prinzip machte bald Schule. Als Nächstes sprang die Telekom mit dem Angebot Electronic Beats auf den Zug auf und fokussierte sich dabei mit den Slices-Dokumentationen und anderen Formaten auf eine Art Alternativ-Musikjournalismus – just in einem Moment, in dem die klassische Musikpresse sich mit einer Krise konfrontiert sah und über zunehmend eingeschränkte Mittel verfügte, also weniger konkurrenzfähig war. Die RBMA und EB schufen mit alledem den neuen Maßstab für ausgedehnte Werbekampagnen in der weltweiten Clubkultur. Diese fanden nicht mehr einfach nur below the line statt, sondern griffen noch einmal eine Etage tiefer an. Sie besetzten die Infrastrukturen der Szene oder ersetzten sie gar mit eigenen. Die Alkoholmarken zogen selbstverständlich bald nach.
Alkohol und Clubkultur: eine subtile Mischung
Ab Ende der 2000er-Jahre erlebte Clubmusik wieder eine Hochkonjunktur und der Hype der 1990er-Jahre schien sich unter neuen Vorzeichen zu wiederholen. Seit den 2010er-Jahren ahmten deshalb Marken wie Smirnoff, Jägermeister oder die zu Pernod Ricard gehörende Whisky-Marke Ballentine’s, die seit nunmehr über einem Jahrzehnt mit Boiler Room kollaboriert, von RBMA und EB etablierte Prinzipien nach. An der verworrenen Geschichte des im Jahr 2010 im titelgebenden Heizungskeller lancierten Veranstalters und Live-Streamers Boiler Room allein lässt sich nachverfolgen, wie Alkoholmarken die Szene seit geraumer Zeit prägen. Sie wollen ihre Produkte nicht mehr nur mit dem Lifestyle der ravenden Gesellschaft in Verbindung bringen, sondern Teil der Szene werden.
Die RBMA meisterte bravourös den Übergang ins digitale Zeitalter, das heißt die Dynamiken des sogenannten Web 2.0 mit seinem deutlichen Fokus auf (audio-)visuelle Inhalte. Das mag freilich dem strategischen Geschick von Yadastar zuzuschreiben sein, erhält vor dem Hintergrund der eigentlichen Mission – eine Marke so nachhaltig und doch subtil wie möglich zu bewerben – allerdings eine noch ganz andere Dimension. "Das Produkt wird nicht ins Rampenlicht gezwängt. Keine alles für sich vereinnahmende Absichten", schwärmt Andy Crysell in Selling the Night über die RBMA, und geht damit gewissermaßen der Strategie des Ganzen auf den Leim. Denn der Name Red Bull und die Marke mit all ihren Absichten waren natürlich immer überall deutlich präsent.
In der Passage offenbart sich, wie erfolgreich die RBMA die Marke des dahinterstehenden Unternehmens in der Szene etablierte, ohne dass dies überhaupt in vollem Umfang registriert wurde. Ein weiteres Beispiel ist der jüngere kulturelle Trend um sogenannte "Listening Bars" nach dem Vorbild japanischer (jazz) kissa, der maßgeblich das Resultat einer vom Alkoholhersteller Asahi Super Dry in Kollaboration mit der Ticketing-Plattform Resident Advisor lancierten Kampagne zu sein scheint und dennoch die Großstädte erobert. Marken gehen in ihrem Marketing also weit über die übliche Imagepflege hinaus. Sie inszenieren sich sogar als moralische Instanzen oder aber als Retterinnen der Szene in Krisenzeiten. Damit versuchen sie, szeneinterne Diskurse für sich zu nutzen und auf sie einzuwirken.
Emanzipation durch Schnaps?
Das Aufkommen von Social Media sorgte für mehr buchstäbliche Sichtbarkeit für DJs, die sich – nicht nur in diesem Kontext gesprochen: ironischerweise – selbst zunehmend wie Marken gerierten und als Influencer:innen auftraten. Das öffnete auch Tür und Tor für neue Werbemaßnahmen. Zugleich beförderten die neuen Netzwerke einen Austausch, in dessen Rahmen die fundamentalen Werte neu verhandelt wurden. Der alten Formel PLUR (Peace, Love, Unity, Respect) wurde ein neues Verständnis von Clubmusik entgegengestellt, das den Rave zu einer inhärent politischen Angelegenheit hochstilisierte. Der Wertekanon verschob sich mehr oder minder subtil von Hedonismus und Fun-Diktat hin zu identitätspolitischen Fragen, wie sie die 2010er-Jahre insgesamt dominierten.
Den Marketing-Abteilungen dieser Welt kamen diese durchaus ebenso ernstgemeinten wie wohlmeinenden Anstrengungen, offener und direkter mit unterschiedlichen Marginalisierungsphänomenen innerhalb der Szene und darüber hinaus umzugehen, dem Anschein nach sehr gelegen. Denn was die einen als Intersektionalität bezeichnen, das heißt bei ihnen Zielgruppensegmentierung. Ähnlich wie Jahrzehnte zuvor Absolut versuchten nun Alkoholmarken zunehmend Politik zu machen und etwa queere Stimmen als brand ambassadors für sich zu gewinnen, darunter allein im Jahr 2021 Budweiser mit der Doku Underplayed und Ballentine’s mit dem Resetting the Dancefloor Report (an dem Crysell übrigens federführend beteiligt war) sowie schon zuvor Smirnoff mit dem Projekt Equalizer.
Bei Equalizer handelte es sich um eine Markenkollaboration zwischen Spotify und Smirnoff, die von Honey Dijon beworben wurde. Das Prinzip war ebenso simpel wie hirnverbrannt: Anlässlich des Feministischen Kampftages am 8. März 2018 rollten beide Unternehmen ein Analyse-Tool aus, mit der das Hörverhalten von Nutzer:innen in Bezug auf das Genderverhältnis der gestreamten Künstler:innen analysiert wurde. Perfide war das allein, weil Spotify sehr wohl selbst in der Lage wäre, das Publikum mit paritätischer beziehungsweise diverser besetzten Playlists zu versorgen. Auch ist Alkohol wie der von Smirnoff ein Faktor bei der Gewaltausübung gegenüber Frauen und die queere Szene, wie von Dijon repräsentiert, zudem überdurchschnittlich hoch von Abhängigkeit betroffen.
Zudem implizierte die Kampagne eine Eigenverantwortlichkeit des Publikums, die dem politischen (Selbst-)Anspruch der Szene zuwiderlief: individuelle Schuldzuweisungen statt struktureller Lösungsansätze – mit dem Zweck, eine für ihre ausbeuterischen Mechanismen immer wieder in der Kritik stehende Streamingplattform sowie einen Hersteller von hochprozentigem Fusel zu bewerben. Zwar wurde viel Kritik an der Kampagne laut und zerlegte etwa die US-amerikanische Journalistin und Spotify-Kritikerin Liz Pelly sie in The Baffler in seine Einzelteile. Doch schien das dem Image der einen wie der anderen Marke nicht nachhaltig zu schaden. Tatsächlich wirkte es umso mehr, als wäre die Szene gleichgültig ob all des Zynismus.

Rettungspakete in flüssiger Form
Die substanziellen Fortschritte der vergangenen Jahre in puncto Gendergerechtigkeit sind nicht auf die kurzlebige Kampagne einer Wodkamarke zurückzuführen. Vielmehr sind sie das Ergebnis der unermüdlichen und meistens unbezahlten Arbeit von Initiativen wie dem international aktiven Netzwerk female:pressure. Insbesondere die regelmäßig veröffentlichte FACTS-Studie über die merklichen Genderdifferenzen in den Line-ups von Festivals mit einem Schwerpunkt auf elektronische Musik sorgten nicht allein für viel Gesprächsstoff, sondern dank belastbarer Zahlen für inkrementelle Veränderungen innerhalb der Szene. Doch wer im Juli 2025 auf die Website von female:pressure ging, wurde dort unter anderem von einem Spenden-Button begrüßt: Gesammelt wurde für ein überfälliges Website-Redesign.
Der Zielbetrag der Kampagne von 5.000 Euro macht nur einen Bruchteil der Budgets aus, die Unternehmen wie Smirnoff für ein bisschen positive Presse Werbeagenturen zubuttern, die für sie Kampagnen wie Equalizer durchsetzen. Dieser Diskrepanz sind sich solche Marken auch bewusst und erkennen darin ein Potenzial: Entsprechend des RBMA-Playbooks wollen sie sich als Geldgeberinnen noch tiefer in den Infrastrukturen der Szene etablieren. Jägermeister hat diese Strategie wie kein anderer Hersteller perfektioniert. Zwar legte zu Pandemiebeginn im Frühling auch unter anderem Ballentine’s Unterstützungsfonds auf. Jägermeister aber systematisierte solche Hilfestellungen in bisher nicht gekanntem Ausmaß. Obwohl die Sache holprig anfing.
Die Kampagne Save The Night wurde im Sommer 2020 zuerst nach dem Vorbild von Krombachers Regenwald-Aktion gestartet: Ein Euro aus dem Verkauf jeder Flasche mit einem speziellen Design ging laut Pressemeldung "an diejenigen, die in der aktuellen Krisensituation bisher nie dagewesene harte Zeiten durchmachen und unmittelbare Unterstützung benötigen" beziehungsweise spendete Jägermeister eine Million Euro an unterschiedliche Betroffene. Kurze Zeit später wurde öffentlich, dass die "Botschafterin" der Kampagne, Peggy Gou, Teile des Fördertopfs an den Glasgower Sub Club versprochen hatte, der von einer Firma getragen wurde, die einem Geschäftspartner der südkoreanischen DJ gehörte. Die Spende wurde storniert, die Save-the-Night-Kampagne aber läuft weiter.
Marketing in anderer Verpackung
Jägermeister ahmte weitgehend den 2019 etablierten True Music Fund von Ballentine’s nach, legte aber mit Best Nights VC im Jahr 2023 einen Fonds für Risikokapital nach, der in unterschiedliche Initiativen beziehungsweise Start-ups mit Bezug zu Nachtleben und Clubkultur investiert. Junge Firmen wie die Berliner "Experience-Production-Company" Realtainment (die anscheinend Malkurse anbietet), die dänische "Premium Party Lifestyle Company" Soundboks (ein Technikverleih für Partys) oder die Event-Planungs-App Togather erhielten kapitale Starthilfen. Wenn Crysell in Selling the Night die "Innovation Ecosystem Strategist" Andrea Rosen von Best Nights VC mit Worten zitiert, das Nachtleben stelle für den Fonds ein "strategisches Asset" dar, ist das auf verschiedene Arten nur korrekt.
Denn einerseits scheint das alles auf den ersten Blick nur eine Investition in die Stärkung eines Nachtlebens darzustellen, von der sich ein Alkoholhersteller wie Jägermeister die Stärkung eines Absatzmarktes verspricht. Außerdem könnte sich die Sache finanziell lohnen, sollten diese Start-ups erfolgreich werden. Andererseits heißt Risikokapital nicht ohne Grund so: Drei Viertel aller Investitionen gehen ins Leere. So stellt sich die Frage, wie ernst es Jägermeister als Firma mit dieser Initiative ist, und vor allem, ob sie in einem für die Clubkultur kritischen wirtschaftlichen Moment wirklich dauerhafte Unterstützung bietet – oder ob Best Nights VC eben doch nur kurzfristig mit vergleichsweise wenigen Geldmitteln und einem werbewirksamen Konzept das Image der Firma aufpolieren soll.
Crysell räumt ein, dass derlei Aktionen genauso als "Marketing-Kampagnen in einer anderen Verpackung" verstanden werden können. Er weist in seinem Buch darauf hin, dass die üppigen Budgets jederzeit gestrichen werden können. "Wenn du dich auf einen großen Markt fokussierst und es zu einer Rezession kommt, kann das kulturelle Marketing zuerst wegfallen", zitiert er Dan Maurice vom Absolut- und Ballentine’s-Hersteller Pernod Ricard. Tatsächlich zeigt allein die Geschichte der RBMA, wie wenig Verlass auf die Nachhaltigkeit von kulturellem Marketing ist: Nachdem Red Bull das Projekt eingestellt hatte, war es das mit Workshops, Events und Lectures und den damit verbundenen Einnahmen. Wie lange aber werden Alkoholmarken noch ein Interesse daran haben, die Nacht zu retten?
Im Laufe der 2010er-Jahre verstanden sie, dass es für ihre Imagepflege und die Integration ihrer Marke nicht mehr ausreichte, bloß aufsehenerregende Events zu produzieren und zum Beispiel Peggy Gou im "tiefsten Pool der Welt" auftreten zu lassen. Nach dem Vorbild der RBMA versuchten sie sich auf ideologischer und infrastruktureller Ebene noch viel tiefer in der Szene zu installieren. Ihre Investitionen könnten die Abhängigkeit der gesamten Clubkultur vom Geschäft mit dem Alkohol nur verschärfen – und womöglich nicht von allzu langer Dauer sein. Spätestens wenn der Hype um Clubmusik wieder abflaut, wird sich zeigen, wie ernst es all diesen Firmen damit ist, die dazugehörige Kultur zu unterstützen. Oder ob sie doch nur eine ganze Szene als Werbefläche bespielen wollten.




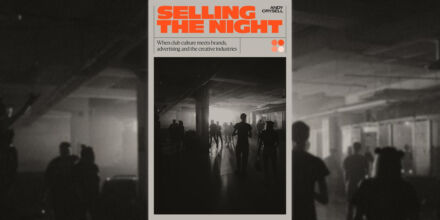
0 Kommentare zu "Szene am Tropf. Clubkultur und Alkohol, Teil 2: Eine Szene als Werbefläche"