Für viele Menschen gehören Rave und Rausch zusammen. Das tun sie auch auf anderer Ebene: Clubs und in geringerem Maße Festivals sind von Alkohol als einer zentralen Einnahmequelle wirtschaftlich abhängig. Im ersten Teil unserer Recherche geht es um die Geschichte und Besonderheiten der Verflechtungen von Clubkultur und Alkoholindustrie.
Auch interessant

Gehören Rave und Rausch zwangsläufig zusammen? Die Frage wurde zuletzt häufiger gestellt. Laut diversen Erhebungen trinken Mitglieder der Gen Z weniger als vorausgehende Generationen und allein wegen der wirtschaftlich angespannten Situation werden auch diejenigen, die nicht grundlegend abstinent feiern wollen, ihren Konsum maßvoller gestalten. Wohl auch deswegen erhalten Initiativen wie Sober Nightlife und Veranstaltungsreihen wie Sober Sensation, Lemonade Queers und Tendersesh auch über den sogenannten Dry January hinaus zunehmend Aufmerksamkeit. Diese nüchternen Formate beweisen hinlänglich, dass es sich völlig ohne jedwede neurotoxische Substanzen Spaß haben lässt. Ein positiver Trend? Schon. Wäre da nicht ein Problem.
Die Clubszene hängt am Tropf der Alkoholindustrie. Sie ist wirtschaftlich von den Einnahmen aus ihrem gastronomischen Angebot abhängig, wovon alkoholische Getränke den Löwenanteil ausmachen. Doch spielte Alkohol in den Keimzellen der Clubkultur, wie wir sie heute kennen, lange Zeit eine kleine Rolle. "Wir nahmen LSD zur Hilfe – nicht Alkohol", frotzelte Nicky Siano von The Gallery in Andy Crysells Buch Selling the Night. When Club Culture Meets Brands, Advertising and the Creative Industries. Auch in anderen Clubs der Disco-Ära und frühen House-Zeit wie in David Mancusos Loft oder der Paradise Garage wurde kein Alkohol verkauft. Aus verschiedenen Gründen: Mancuso wollte seine Partys unkommerziell halten und die Garage konnte deshalb länger öffnen als reguläre Bars.
In der Geschichte der Clubkultur finden sich noch weitere Beispiele dafür, dass Techno und House nicht immer mit Bier und Schnaps einhergingen oder sich durch sie finanzierten. Crysell berichtet in seinem Buch über die Verflechtungen von Clubkultur und Markenwelt sogar, dass die Acid-House-Euphorie während des Second Summer of Love die Alkoholindustrie vor ein ernsthaftes Problem stellte: Die Jugend ging lieber auf Raves statt in Pubs und trank selbst in Clubs meistens nur Wasser – ihr Treibstoff kam stattdessen in Pillen- oder Pulverform. Und in Berlin braute zur selben Zeit der Tresor-Gründer Dimitri Hegemann im Fischbüro ein experimentelles "Spacebier", statt Sterni abzuverkaufen. Selbst wenn also getrunken und Alkohol angeboten wurde, ging es nicht zwangsläufig um Wirtschaftlichkeit.
Doch der weitgehende Verzicht auf Alkohol beziehungsweise auf dessen Verkauf wurde von externen Bedingungen begünstigt. Darunter fallen etwa wirtschaftliche Vorteile wie – ob nun im New York der 1970er-Jahre oder im wiedervereinten Berlin – niedrige oder überhaupt nicht anfallende Mieten und relativ niedrige allgemeine Kosten. Das ermöglichte es, weitgehend auf ein gastronomisches Angebot zu verzichten. Auch behördliche Auflagen stellten nicht nur im Falle der Paradise Garage wichtige Faktoren dar. Als sie sich änderten, gewann Alkohol wieder an Bedeutung: Nachdem die britische Regierung den Raves im Londoner Umfland mit repressiven Maßnahmen und sogar einem Gesetz einen Riegel vorgeschoben hatte, zwang das die Szene wieder in die Clubs. Und also zurück an die Theke.
Diese Entwicklungen gingen Hand in Hand mit der zunehmenden Professionalisierung der Szene im Laufe der 1990er-Jahre. Schon in der Disco-Ära existierten parallel zu Orten wie dem Loft und der Gallery große und kommerziell ausgerichtete Clubs wie das Studio54. Ebenso formierten sich noch während der anarchischen ersten Jahre von Techno und Acid House kommerziell operierende Clubs, die mit härteren Auflagen und also mehr Kostendruck konfrontiert waren. Ihre Einnahmen generierten sich aus zwei verschiedenen Quellen: den Eintrittspreisen einerseits, den Barverkäufen andererseits. Deshalb ist heutzutage so gut wie jeder Club sowie fast jedes Festival (wenn auch in geringerem Maße) alkoholabhängig. Doch was bedeutet das konkret in wirtschaftlicher Hinsicht?

Die Bar: Die größte Einnahmequelle eines Clubs
Musik war immer schon ein zentraler Teil des Nachtlebens, weshalb sie seit Jahrhunderten mit Alkohol verbunden ist. Noch bevor zum Four-to-the-Floor getanzt wurde, spielten Bands in Bars auf oder lief zumindest eine Jukebox. Auch bei regulären Konzerten, ob nun mit Jazz oder Black Metal, wird ein Teil der Einnahmen für die jeweilige Veranstaltungsstätte über die Bar eingenommen. Doch die wirtschaftlichen Rechnungen von Live- und von Techno-Clubs unterscheiden sich. Zwar haben beide zwei primäre Einnahmequellen, die zu unterschiedlichen Teilen in die Gesamtrechnung einfließen – den Eintritt und die Gastronomie. Doch spiegeln sich die Differenzen zwischen den jeweiligen Veranstaltungsformaten auch in einem jeweils anderen Verhalten des Publikums wider.
Ein Konzertabend dauert selten länger als fünf Stunden und fordert während der einzelnen Sets die ungeteilte Aufmerksamkeit des Publikums ein. Getränke werden dabei also eher nur punktuell in der Pause zwischen zwei Auftritten gekauft. Weil viele Konzerte unter der Woche stattfinden und sie in der Breite nicht als Anlässe verstanden werden, über die Stränge zu schlagen, ist dementsprechend der Konsum maßvoller – sowohl was die Anzahl der Drinks als auch deren alkoholischen Gehalt anbelangt. Clubnächte hingegen finden meistens am Wochenende statt und gehen weitaus länger. Teile des Publikums legen es dezidiert darauf an, sich mittels diverser Substanzen ein bisschen von der Realität abzukapseln, und Alkohol ist dafür ein probates Mittel, zu dem quasi jederzeit gegriffen wird.
Deshalb stellt die Gastronomie in der Szene die Haupteinnahmequelle dar. "Je nach Club machen Eintrittspreise 20 bis 40 Prozent des Umsatzes aus, der Rest wird an der Bar eingenommen", erklärt Marcel Weber, Vorstandsvorsitzender der Berliner Clubcommission. Zum Vergleich: Laut Axel Ballreich vom Branchenverband LiveKomm ist dieses Verhältnis bei Live-Konzerten "umgekehrt". Und weil Alkohol das nahezu perfekte Produkt ist – der Konsum einer Einheit macht Lust auf die nächste –, generiert sich durch ihn wiederum ein Großteil von diesen knappen zwei Dritteln der Gesamteinnahmen, ob nun in Form vom Warm-up-Bier oder doch den Kräuterschnaps-als-Zahnputzersatz nach zehn Stunden. Clubs sind daher maßgeblich wirtschaftlich auf Bier- und Spirituosenverkäufe angewiesen.
Bei Festivals verhält es sich etwas anders. Ballreich sagt, dass vor allem Festivals für bis zu 10.000 Besucher:innen ihr eigenes gastronomisches Angebot stellen. Ab einer Kapazität von über 20.000 würden sie mit externen Anbieter:innen zusammenarbeiten, die für diese Dienstleistung natürlich auch einen Teil der Einnahmen einstreichen. Weil aber Festivals in der Regel hohe Ticketpreise aufrufen, fällt der Anteil von Verkäufen im Kontext der Gesamteinnahmen insgesamt weniger ins Gewicht. "Das gastronomische Angebot macht ungefähr 15 bis maximal 30 Prozent des Umsatzes aus", meint Ballreich. Doch auch hier gelte: "Bei Techno-Festivals macht der gastronomische Umsatz mehr aus als in anderen Genres." Wie also im Vergleich zwischen Clubs und Live-Spielstätten zeigt sich, dass Alkohol eine besondere Rolle in der wirtschaftlichen Gesamtrechnung der Szene spielt.
Exkurs: Nüchternheit, ein Risikogeschäft
Das unterstreichen die Aussagen von Veranstalter:innen der Raves, die frei von Neurotoxinen sind und daher komplett auf Einnahmen aus dem Verkauf von Alkohol verzichten – weshalb sie häufig an ganz anderen Orten stattfinden als in regulären Clubs. "Viele Clubs sagen dir sofort, dass ohne Barumsatz nichts geht", berichtete DJ Flounce von Tendersesh kürzlich in einem Groove-Interview. Dazu kommen zum Teil erhöhte Kosten, wenn nüchterne Veranstaltungen doch in Clubs oder aber, wie es gelegentlich der Fall ist, in regulären Bars stattfinden. Denn alle Hinweise auf deren sonstiges alkoholisches Angebot werden abgedeckt und es müssen zusätzliche Ruheräume eingerichtet oder andere Maßnahmen ergriffen werden, um den Bedürfnissen von trockenen Alkoholiker:innen gerecht zu werden.

Findungsschwierigkeiten von Veranstaltungsorten und ein erhöhter Arbeitsaufwand treffen außerdem auf potenziell niedrigere Einnahmen, die jedes Event zu einem Risikogeschäft machen. Zwar gibt es bei Veranstaltungen wie Tendersesh oder Lemonade Queers reguläre alkoholfreie Getränke oder sogar aufwändige "Mocktails" zu kaufen. "Aber die Gewinnmarge ist wegen des zusätzlichen Arbeitsaufwands und der höheren Materialkosten kleiner", sagt Vlady Schklover von Lemonade Queers. Seine kostenfreien Veranstaltungen finanzieren sich weithin über öffentliche Förderungen. Um sich ohne diese Stütze zu tragen, müsste er laut Berechnungen einen Eintrittspreis von 30 Euro nehmen. Das würde potenziell Gäste abschrecken, weshalb sich die Veranstaltung wohl immer noch nicht tragen könnte.
Tatsächlich steht kaum eine der zuletzt viel diskutierten, nüchternen Veranstaltungsreihen auf eigenen Füßen. Einige von ihnen finanzieren sich entweder durch harte Selbstausbeutung oder eigene Kosten, andere nehmen wie Lemonade Queers Förderprogramme wahr oder kooperieren mit privaten Geldgeberinnen wie im Falle der aktuell pausierenden Sober Sensation, die unter anderem mit Krankenkassen zusammengearbeitet hat. Mithilfe des Publikums allein könnten sie nur dann finanziert werden, wenn sie drastisch ihre Eintrittspreise erhöhen. Wie bei Live-Veranstaltungen würde das den Druck bezüglich der Barverkäufe mindern, aber zugleich ein Risiko darstellen. Für Clubbesuche so viel wie für ein Konzert zu bezahlen, das kommt für viele nicht infrage.
Rückvergütung: Kommissionen und Kredite unter anderem Namen
Bei der bloßen Abhängigkeit von Alkohol als Teil des gastronomischen Angebots von Clubs und Festivals enden die Verbindungen zwischen Szene und Alkoholindustrie noch lange nicht. Denn Clubs sind über Verträge an bestimmte Hersteller und Getränkevertriebe gebunden, was ihre Abhängigkeit – insbesondere hinsichtlich einer sich zunehmend monopolisierenden Alkoholbranche – nur mehr verschärft. Auf der anderen Seite ist es allerdings für Brauereien und Schnapshersteller wirtschaftlich und werberisch wichtig, im coolen subkulturellen Kontext stattzufinden. Die Abhängigkeit ist somit eine gegenseitige: Clubs sind schließlich nicht einfach Abnehmer von Produkten, sondern fördern deren Absatz. Das wiederum wollen die Hersteller unterstützen.
Deswegen besteht eine für Außenstehende sonderbare wirtschaftliche Verbindung zwischen diesen beiden Parteien: das System der Rückvergütung. Die Lieferanten, die Clubs und Festivals mit alkoholischen Getränken versorgen, melden in regelmäßigen Abständen Absatzzahlen an die Hersteller von Bier und Spirituosen. "Für jeden verkauften Hektoliter Bier oder jede Flasche Schnaps bekommt der Club Geld ausgezahlt", erklärt Marcel Weber von der Berliner Clubcommission das Prinzip, vergleichbar mit einer Kommission oder einer Form von Prämie. So funktioniert es auch bei Festivals, bestätigt Axel Ballreich von der LiveKomm. So kompliziert das klingt – warum nicht gleich einen Rabatt geben? –, so ist es das Resultat der gegenseitigen Abhängigkeit: Laufend werden finanzielle Anreize gegeben.
So bedingt das System der Rückvergütung, dass die Wirkstätten der elektronischen Musik jederzeit versuchen, möglichst viele alkoholische Getränke abzusetzen. Umso mehr, wenn wie in seltenen Fällen eine sogenannte vorgezogene Rückvergütung stattfindet, das heißt Brauereien vor der Eröffnung eines Clubs Geld beisteuern, das nach und nach abgestottert wird. "Wer einen Club eröffnen will, braucht heute mehr denn je Investitionsmittel", erklärt Weber diesen Kredit unter einem anderen Namen. "Brauereien haben eine höhere Risikobereitschaft als viele Banken, weil sie einen Kundenstamm an sich binden wollen. Deshalb sind bereit, etwas dazuzugeben. Stellenweise bieten sie sogar Darlehen an oder beteiligen sich an Investitionen."
Werbekostenzuschüsse: Die Glastür im Kühlschrank
Auch wenn alkoholische Geldspritzen in diesem Umfang selten verabreicht werden, beteiligen sich Hersteller noch auf verschiedenen anderen Ebenen als Geldgeber für Clubs, Festivals und vereinzelt sogar Promoter:innen. "Werbekostenzuschuss" ist noch so ein eher komplizierter Begriff, der – und wenn nur unter dem Kürzel WKZ – zum alltäglichen Sprachgebrauch vieler Clubbetreiber:innen gehört. Gegen Geldzahlungen oder die Bereitstellung von bestimmten Dienstleistungen oder Materialien verpflichten sich Clubs, Festivals oder Promoter:innen, bei ihren Veranstaltungen Werbeflächen zur Verfügung zu stellen. Das kann angefangen mit Platzierungen von Logos im Club bis hin zu Posts in Social Media allerhand umfassen, und es beschränkt sich nicht allein auf die Bar.
Der prominenteste Repräsentant von Werbekostenzuschüssen in einem Club findet sich jeder hinter fast jeder Theke. Wer sich jemals gefragt hat, warum die dortigen Kühlschränke in der Regel mit einer Glasscheibe ausgestattet sind: Das soll nicht etwa dem Personal die Arbeit erleichtern, sondern dem Publikum am sogenannten point of sale den Blick auf Bier X oder Schnaps Y frei machen. Marcel Weber erzählt, dass auch mal ganze DJ-Pulte mit Geldern von Alkoholfirmen finanziert werden, die im Gegenzug ihre Marken prominent an der Booth platziert haben wollen. Im Laufe der Zeit, sagt er jedoch ebenso, haben sich diese Sponsoring-Deals nachhaltig verschoben. "Die Hochphase waren die frühen 2000er-Jahre, damals klebten auch mal bis zu 50 Logos auf Veranstaltungspostern", erinnert er sich.
Das ist heutzutage eher von Festivals bekannt. Sie erlauben es Marken, in einem konzentrierten Zeitraum eine große Anzahl von durstigen Menschen mit ihren Produkten in Berührung zu bringen. Neben klassischen WKZ-Deals errichten manche Hersteller sogar eigene Stände bei Festivals, erklärt Axel Ballreich von der LiveKomm. Oder sie stellen Personal zur Verfügung, als "Win-win-Situation", weil die einen ihr Sortiment am point of sale bewerben können und die anderen Ausgaben sparen. Ähnliches gilt für die manchmal auf Festivals zu findenden gesponserten Festivalbühnen mit Branding. In Einzelfällen wird sogar von den Marketing-Teams der Alkoholhersteller deren Line-up kuratiert. Für eine Schnapsmarke auflegen – klingt bizarr? Doch tun das gewissermaßen alle DJs.

Clubkultur: Unbequeme Wahrheiten - DJs als verlängerte Theke?
Die wechselseitige Abhängigkeit zwischen Alkoholindustrie und Clubkultur wirft einige Fragen auf. Wenn Clubs sich maßgeblich durch den Verkauf von Alkohol finanzieren, wenn in manchen Fällen selbst das Equipment mit den Geldern der Industrie finanziert werden – was sagt das eigentlich über diese Orte aus, die sich als Kulturstätten verstehen beziehungsweise in Deutschland mittlerweile – zumindest in der Theorie – auch als solche anerkannt werden? Und was über diejenigen, die dort Nacht für Nacht ein Handwerk erledigen, das sie als Kunst verstehen? "Du bist eine Alkohol-Verkaufsmaschine!", gab Jayda G vor Jahren unumwunden in einem Groove-Interview zu. "Der halbe Grund, wieso du gebucht wirst, ist doch, dass Leute kommen und Alkohol kaufen werden."
Die Kanadierin sprach damit eine unbequeme Wahrheit aus, die innerhalb der Szene selten diskutiert wurde. In seinem Newsletter A Certain Sound rechnete der Journalist, DJ und Promoter Chris Zaldua den Grundwiderspruch zwischen künstlerischem (Selbst-)Anspruch und der nüchternen Zahlenmagie einer jeden feuchtfröhlichen Nacht modellhaft vor. "Wenn wir davon ausgehen, dass 1.200 Gäste je 50 Dollar an der Bar ausgeben, nimmt der Club 60.000 Dollar ein", schreibt er. "Einem Richie Hawtin 20.000 Dollar (zuzüglich Kosten für Flug, Hotel, Fahrtkosten, Verpflegung, Booking-Gebühr und Hospitality-Aufschlag) für ein drei- bis vierstündiges DJ-Set zu zahlen, rechnet sich einfach." Klingt zynisch, doch selbst auf Underground-Level wird ähnlich kalkuliert – weil alle Clubbetreiber:innen es müssen.
Geradezu entwaffnend ehrliche Eingeständnisse wie die von Jayda G oder Einwürfe wie die von Zaldua – der seine Rechnung anlässlich der hitzigen Diskussion um das Ende von Aslice aufstellte – haben Seltenheitswert. Das mag auch daran liegen, dass die tiefe und vielschichtige Abhängigkeit vom Geschäft mit Alkohol im krassen Widerspruch zum Selbstverständnis von Clubs steht. "Wie kann man es denn gut finden, dass man einen kulturellen Ort betreibt und davon lebt, ein Nervengift zu verkaufen, das viele Menschen in den gesundheitlichen und sozialen Ruin treibt?", bringt Marcel Weber es auf den Punkt. Zwar würde im linken Spektrum durchaus darüber gesprochen, sich aus diesen Abhängigkeiten zu lösen. Doch: "Wer auch immer es versucht, trägt das volle wirtschaftliche Risiko."
Gestiegene Preise, verringerte Margen und unsichere Perspektiven
Dabei ist nicht einmal mehr Verlass auf das Geschäft mit Alkohol. In der zunehmend konsolidierten Branche haben viele Hersteller ihre Preise erhöht, bemängelt Axel Ballreich. "Eine Marktmacht innezuhaben, bedeutet, über die Preisgestaltung verfügen zu können", sagt er mit Blick auf die führenden Konzerne und Lieferanten. "Grundsätzlich hat die Preispolitik seit Beginn der Pandemie einen deutlichen Aufschwung erlebt. Und wir reden nicht von drei oder fünf Prozent pro Jahr, sondern Anstiegen im unteren zweistelligen Prozentbereich." Deshalb steigen zwar in den Clubs die Pro-Kopf-Umsätze, wie Marcel Weber es beobachtet – doch mit dem Umsatz noch lange nicht der Gewinn. Weil in der Breite nicht mehr so viele Gäste kommen wie noch vor der Pandemie, sinken die Absatzzahlen in der Gesamtheit.
So ist also die Zweckehe zwischen Clubszene und Alkoholindustrie an einem kritischen Punkt angekommen. Die eine wird sich aber so schnell nicht von der anderen lösen können, solange sich nicht holistischer gedachte und vor allem erwiesenermaßen wirtschaftlich tragbare Modelle für einen Clubbetrieb finden lassen, in deren Rechnung die Bar nur einen kleinen Anteil ausmacht. Einfach nur darauf zu hoffen, dass das – wirtschaftlich ebenfalls stark beeinträchtigte – Publikum wieder in Trinklaune kommt, scheint zumindest zweifelhaft. Und darauf zu spekulieren, dass sinkende Bareinnahmen durch höhere Ticketpreise kompensiert werden können, um in der Bilanz wie bei Live-Konzerten das Verhältnis zwischen beidem umzukehren, scheint ebenfalls fatal.
Erschwerend kommt hinzu, dass sich die Alkoholindustrie auch weitab der Theke und außerhalb von Clubs in die umgebende Subkultur fest eingeschrieben hat, ja mittlerweile sogar selbst den Ton anzugeben versucht. Im zweiten Teil unserer Recherche geht es deshalb darum, wie sich einige Marken mittels kulturellen Marketings tief in die Infrastrukturen der Szene eingekauft haben – oder, je nach Betrachtungsweise, diese sich an die Alkoholbranche verkauft haben.




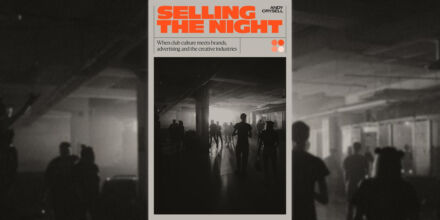
0 Kommentare zu "Szene am Tropf. Clubkultur und Alkohol, Teil 1: An der Bar und hinter den Kulissen"