Wie Geld im Streaming verteilt wird
Spotify steht mal wieder in der Kritik. Dabei geht es auch um die Ausschüttungen durch die Plattform. Nur 0,3 Cent zahle sie pro Stream, heißt es allenthalben. Das ist so nicht richtig und stört die Diskussion um die eigentlichen Probleme, kommentiert Kristoffer Cornils.
Es wird wieder viel über Spotify gesprochen. Die Plattform wird mit KI-Fakes wie Velvet Sundown geflutet, selbst auf den Accounts von toten Country-Künstlern tauchen nunmehr vollständig KI-generierte Stücke auf, die nicht von ihnen sind. Mit KI hat auch der größte Aufreger der jüngeren Zeit zu tun: Über seine Investmentfirma Prima Materia hat Daniel Ek dem Münchener Unternehmen Helsing eine fette Finanzierungsspritze verabreicht, insgesamt 600 Millionen erhielt der Hersteller von KI-gestützter Militärtechnologie. Nachdem Ek zuletzt Spotify-Aktien im Wert von über 800 Millionen Euro abgestoßen hatte, sahen viele einen Zusammenhang zwischen dem einen und dem anderen. "Wir wollen nicht, dass unsere Musik Menschen tötet", schrieb die Indie-Rock-Band Deerhoof in einem Instagram-Post, mit dem sie ihre Abkehr von der Plattform ankündigte. Sie sind nicht die einzigen, die so denken.
Es mag scheinheilig anmuten, wenn Deerhoof, Xiu Xiu, King Gizzard & The Lizard Wizard, Cindy Lee sowie Labels wie Ilian Tape – das nach Eks erster Investition in Helsing im Jahr 2021 seinen Katalog dort abzog – und zuletzt Kalahari Oyster Cult ihre Musik von dieser Plattform nehmen, andere jedoch weiterhin nutzen. Meta, Google, Apple oder Amazon: All diese Firmen sind mit der Musikwelt verflochten, keine hat eine weiße Weste und werden aber nicht zur Zielscheibe. Doch geht es bei der Frustration über Spotify um mehr als moralische Fragen. Der Marktführer steht schon lange wegen wirtschaftlicher Aspekte in der Kritik. "Künstler:innen bekommen pro Stream nicht mal einen halben Cent, 0,3 Cent, um genau zu sein", hieß es vor einer Weile etwa in einem Kommentar in der taz. Diese oder sehr ähnliche Zahlen werden oft genannt.

Nur stimmt das so nicht. Krude Zahlenspiele wie diese zeugen vielmehr von Unverständnis über die wirklichen Mechanismen der Streamingwirtschaft. Sie stehen damit leider repräsentativ dafür, wie in weiten Teilen der Medien und auch der Musikwelt Kritik an Spotify und Streaming insgesamt geäußert wird. Das lenkt vom eigentlichen Problem ab. Wir müssen also dringend darüber reden, wie die Gelder im Streaming wirklich verteilt werden. Und dafür ganz am Anfang beginnen.
Wofür wird überhaupt Geld ausgeschüttet?
Zuallererst gibt es zwei verschiedene Arten von Rechten an Musik, die verschieden verwertet werden. Da wäre zum einen das, was gemeinhin unter dem Begriff Publishing zusammengefasst wird. Dabei geht es um im klassischen Sinne urheberrechtliche Ansprüche an der Komposition (Songwriting) und der Textdichtung (Lyrics). Diese Rechte teilen sich in vielen Fällen unterschiedliche Personen entsprechend ihres jeweiligen Beitrags zu einem Stück Musik. Die Rechte werden oft von Verlagen verwaltet. Diese melden Kompositionen bei den Verwertungsgesellschaften an, die wiederum stellvertretend für alle Rechteinhaber:innen Lizenzverträge mit unter anderem Streamingplattformen abschließen und von ihnen Geld für die Nutzung der urheberrechtlich geschützten Werke einsammeln.
Publishing-Rechte gehen auf Zeiten zurück, als sich das Urheberrecht primär auf schriftliche Werke bezog – daher der Name. Dazu gesellte sich nach dem Aufkommen von Wiedergabetechnologien wie dem Phonographen und der Errichtung der Tonträgerindustrie Anfang des 20. Jahrhunderts ein zweiter Bereich: Recorded. Das ist der Oberbegriff für alles, was mit sogenannten Master-Rechten zu tun hat, Ansprüche an Musikaufnahmen. Auch dabei teilen sich Musiker:innen – konkreter wird von Interpret:innen gesprochen – anteilig Rechte miteinander oder etwa Produzent:innen. Die Unterscheidung vom Publishing ist deshalb sinnvoll, weil nicht alle Songwriter:innen selbst ihre Musik auch aufnehmen und im umgekehrten Fall viele Interpret:innen nicht unbedingt ihre eigenen Songs schreiben.
Der größte deutsche Hit der 2010er-Jahre wurde zum Beispiel von Kristina Bach komponiert, deren Namen aber einem Großteil des Publikums völlig unbekannt sein dürfte. Den Song "Atemlos durch die Nacht" verbinden sie stattdessen mit Helene Fischer, der Interpretin des Liedes. Als solche hat Fischer lediglich die Rechte an der Aufnahme des Stücks beziehungsweise teilt sie sich mit anderen Beteiligten wie Shirin David, die den Song gemeinsam mit Fischer im Jahr 2023 neu aufnahm, sowie auch ihren Labels, die die verschiedenen Versionen veröffentlicht haben – darunter Polydor, das zum Musikkonzern Universal Music Group (UMG) gehört. So wie sich Komponist:innen die Einnahmen anteilig mit Verlagen teilen, tun es gemeinhin Interpret:innen mit ihren Labels.
Weil die Rechte für Publishing und Recorded unabhängig voneinander existieren, bezahlen Streamingplattformen wie Spotify dafür separat. Schon allein das übergehen die meisten Darstellungen, denen zufolge bei Spotify "Künstler:innen pro Stream 0,3 Cent bekommen". Denn welche Künstler:innen damit genau gemeint sind, bleibt unklar. Obendrein verdienen eben noch andere Parteien an alledem mit – bisweilen nicht zu knapp.
Wer verdient noch an der Musik mit?
Über die Rolle der Labels wird selten diskutiert. Doch waren es einerseits die großen Musikkonzerne wie UMG mitsamt ihrer Labels, die gemeinsam mit YouTube, Spotify und Co. die bis heute geltenden Ausschüttungssysteme erdachten. Andererseits verdienen Labels gemeinhin an der Arbeit der Interpret:innen mit. Eine GEMA-Studie schlüsselte im Jahr 2022 auf, wohin das Geld aus den Einnahmen der Streamingplattformen geht. Durchschnittlich 30 Prozent streichen diese für sich ein. 42,4 Prozent gehen an die Labels, während Interpret:innen nur 12,7 Prozent der Gelder erhalten. Zum Vergleich: 5,3 Prozent gehen laut derselben Studie an Verlage und 9,7 an Komponist:innen und Textdichter:innen. Dass die GEMA auf dem Weg zu ihnen "Verwaltungskosten" auf die Ausschüttungen erhebt, erwähnt die Studie nicht.

Das sind nicht einmal die einzigen Parteien, die neben Komponist:innen und Interpret:innen an den Einnahmen mitverdienen. Niemand kann einfach so die eigene Musik auf die gängigen Streamingplattformen hochladen. Das erledigen sogenannte Digitalvertriebe, die im Gegenzug die Tantiemen von den Diensten erhalten und an die Rechteinhaber:innen auszahlen. In Ausnahmefällen bieten Plattformen wie SoundCloud ein eigenes Vertriebssystem an, Konzerne wie UMG und große Indies wie die Secretly Group haben ihre eigenen. Künstler:innen ohne Labels nutzen in der Regel Vertriebe wie Tunecore oder CD Baby. Die meisten von ihnen tun das für fixe Beträge (etwa pro Veröffentlichung oder pro Jahr gerechnet), manche aber erheben eine Gebühr auf alle Einnahmen und verdienen also auch "pro Stream" mit.
Wenn nun in übellaunigen Kommentaren behauptet wird, "Künstler:innen bekommen pro Stream 0,3 Cent", impliziert das fälschlicherweise, dass erstens Streamingdienste wie Spotify direkt an Komponist:innen oder Interpret:innen Geld auszahlen und zweitens niemand daran mitverdienen würde. Eine der Komplexität der Sachlage angemessene Formulierung klingt freilich sperrig. Die Plattform Qobuz verkündete im April dieses Jahres, im Jahr 2024 einen "durchschnittlichen Betrag von 0,01802 [Euro] pro Stream" an "die Rechteinhaber*innen, die das Geld gemäß den Vertragsbedingungen an Künstler*innen, Songwriter*innen und Komponist*innen weiterverteilen", ausgeschüttet zu haben. Wohlgemerkt beziffert das nur das, was ausgezahlt wird – nicht aber ist damit gesagt, was bei irgendwem ankommt.
Je nachdem, was Vertriebe und Labels oder Verwertungsgesellschaften und Verlage vom Geld einstreichen, kommt es aber zu großen Differenzen zwischen dem, was Streamingplattformen wie Spotify und Qobuz auszahlen und was bei Interpret:innen oder Komponist:innen ankommt. Durch Befragungen unter denen lässt sich zwar ermitteln, was sie durchschnittlich pro Stream erhalten. Von diesen Mittelwerten lässt sich aber nicht ohne Weiteres einfach ableiten, wie viel im Durchschnitt pro Stream ausgeschüttet wurde. Sowieso fluktuieren die Auszahlungen in Abhängigkeit von verschiedenen dynamischen Faktoren. Deshalb ist bei Qobuz von einem "durchschnittlichen Betrag … pro Stream" die Rede, der sich auf einen bestimmten Zeitraum bezieht – es handelt sich um einen Mittelwert.
Denn keine der konventionellen Streamingplattformen hat eine Summe à la "0,3 Cent" festgelegt, die am Ende eines Abrechnungszeitraums schlicht mit der absoluten Anzahl von Streams eines Musikstücks multipliziert wird, bevor der daraus resultierende Betrag dann direkt auf ein Konto überwiesen wird. Das System ist viel komplexer, und die Ausschüttungsmodelle sind es obendrein. Womit wir beim Kernthema angekommen wären.
Wie Streamingplattformen Gelder verteilen
Mit Ausnahme von SoundCloud setzen alle größeren Streamingplattformen auf ein Ausschüttungsmodell, das als "pro rata" bezeichnet wird. Die Einnahmen aus Abonnements (sowie bei Spotify Werbeeinnahmen) werden ausgehend von den Anteilen bestimmter Musikstücke am gesamten Streamingaufkommen innerhalb eines Zeitraums ausgeschüttet. Vereinfacht erklärt: Zahlt jemand zehn Euro pro Monat für ein Spotify-Abo, gehen davon zuerst drei Euro direkt an die Plattform. Die verbliebenen sieben kommen mit allen anderen Einnahmen in einen großen Topf. Dann wird berechnet, welchen Anteil jedes einzelne der aktuell rund 200 Millionen Musikstücke am Gesamtaufkommen von Streams in dieser Zeit hatte. Es wird also kein statischer Wert "pro Stream" ausgezahlt.

Gehen wir der Einfachheit halber davon aus, dass eine Plattform innerhalb eines Monats eine Million Euro durch Abonnements generiert hat und dort eine Milliarde Musikstücke gestreamt wurden, davon 500 Millionen mal die Originalversion von "Atemlos durch die Nacht" und 10.000 mal die neue Single einer Techno-Produzentin. Abzüglich der Plattformgebühr werden 700.000 Euro an die Rechteinhaber:innen von "Atemlos durch die Nacht" ausgezahlt und sieben Euro für die Single unserer fiktiven Künstlerin. Zumindest ist das die Theorie, die Praxis ist nochmal etwas komplizierter. Denn nicht jeder Stream wird gleich bewertet, weil das Pro-Rata-Modell in den vergangenen Jahren von einigen Diensten modifiziert wurde.
Bei Deezer erhalten die Streams von "professionellen Künstler:innen" – alle mit mindestens 1.000 monatlichen Streams von 500 individuellen Nutzer:innen – seit geraumer Zeit einen "double boost", das heißt, sie werden doppelt gezählt. Das schafft Ungerechtigkeiten: "Atemlos durch die Nacht" hätte einen größeren Anteil am Streamingaufkommen, und angenommen, unsere Techno-Produzentin hätte dauerhaft nur 499 Hörer:innen, würde ihr Track nun weniger als sieben Euro einbringen. Ähnlich ist es bei Apple Music, wo alle Künstler:innen mit für Dolby-Atmos-Wiedergabe optimierte Musikstücke im Angebot (unabhängig davon, ob diese auch gestreamt werden) einen etwas kleineren "Boost" erhalten: Streams aus diesen Katalogen fallen zehn Prozent mehr ins Gewicht als andere.
Am unübersichtlichsten wird es in dieser Hinsicht aber beim Marktführer Spotify. Mit der Einführung des Features Discovery Mode bietet der Dienst Künstler:innen und Labels bessere Playlist-Platzierungen an, wenn sie im Gegenzug auf 30 Prozent der Tantiemen verzichten. Auch die Einführung der Monetarisierungsobergrenze von 1.000 Streams pro Jahr bringt noch mehr Variablen in die Rechnung ein. Es ist das krasseste Beispiel dafür, wie bestimmte Musik im Rahmen des Pro-Rata-Modells systematisch benachteiligt werden kann. In der Breite geschieht dies aber auch anderswo. Was definitiv nicht passiert: Dass Spotify "0,3 Cent pro Stream" auszahlt. Selbst als Durchschnittswert verwendet, könnte diese Zahl über den eigentlichen Sachverhalt hinwegtäuschen.
Es könnte weniger sein, als oft behauptet wird
Weil dem YouTuber und Musikproduzenten Benn Jordan alle Rechte an seiner solo produzierten Musik gehören, kann er mit recht hoher Genauigkeit die durchschnittlichen Pro-Stream-Beträge ausrichten, die von verschiedenen Plattformen bei ihm ankommen. In einem Anfang des Jahres veröffentlichten Video tat er genau das – spezifiziert allerdings nicht, ob er sich rein auf Ausnahmen aus dem Recorded-Bereich bezog oder sein Einkommen aus dem Publishing-Segment ebenfalls Teil der Rechnung bildete. So oder so: Umgerechnet durchschnittlich 0,0025 Euro pro Stream von Spotify hatte er zuletzt erhalten – weniger als die oft zitierten 0,3 Cent. Besser schnitten TIDAL (0,68 Cent), Amazon Music (0,83 Cent) und Qobuz (1,18 Cent – exakt wie vom Unternehmen angegeben) ab.
Wohlgemerkt gilt all das in einem Einzelfall für einen bestimmten – von Jordan nicht definierten – Zeitraum, also um eine individuelle Momentaufnahme. Doch präsentierte er im selben Video eine Grafik, in der er seine von ihm errechneten durchschnittlichen Pro-Stream-Einnahmen durch Spotify zwischen den Jahren 2010 und 2024 abbildete. Die Kurve fällt deutlich ab. Inflationsbereinigt handelt es sich laut Jordan um einen Abfall von 68 Prozent. Einen ähnlichen Trend stellte die oben zitierte GEMA-Studie im Streaming insgesamt zwischen den Jahren 2013 und 2021 fest: "Pro 1.000 Streams lag der Umsatz 2013 bei 10,34 EUR. (...) Seitdem ist dieser Wert um 23 % auf 8,12 EUR im Jahr 2021 gefallen." Das ist wohlgemerkt nicht inflationsbereinigt – und ein Mittelwert für alle Plattformen.

Der allgemeine Abwärtstrend hat mit dem Wachstum von Streaming insgesamt zu tun. Immer mehr Menschen hören immer mehr Musik, was sich auf die Verteilung auswirkt. Bei einem Dienst wie Qobuz ist das Publikum etwa vergleichsweise klein und zahlt höhere Abobeiträge als bei der großen Konkurrenz, was in einem höheren Mittelwert resultiert als bei der großen Konkurrenz. Daher drängt die Musikbranche auf Erhöhungen der Beiträge, wie Spotify sie zuletzt ankündigte. Insbesondere in neuen Märkten beziehungsweise wirtschaftsschwachen Ländern sind diese oft sehr niedrig: In Indien kostet das Premium-Abo von Spotify aktuell noch 119 Rupien pro Monat. Das entspricht umgerechnet 1,18 Euro und damit knapp einem Zehntel eines vergleichbaren Abos in Deutschland.
Im Falle von Spotify kommt das sogenannte Freemium-Prinzip erschwerend hinzu. Stand Juli 2025 zählt Spotify 276 Millionen Bezahlabos. Der Dienst wird aber von hunderten Millionen Menschen – konkrete Zahlen zu Gratis-Abos liefert das Unternehmen nicht – umsonst genutzt. Aus der kostenfreien Nutzung werden Teile der damit generierten Werbeeinnahmen für die Tantiemenausschüttung bereitgestellt. Diese sind aber keineswegs vergleichbar mit den Einnahmen aus den Aboeinnahmen. Das wirkt sich selbstverständlich auf die Höhe der wie auch immer berechneten Durchschnittswerte aus – und zwar nicht im Positiven. Es ist relativ gesprochen weniger Geld im sprichwörtlichen Topf als anderswo. Doch wird nur selten gefordert, Spotify solle sein Freemium-Modell aufgeben. Wieso?
Was eigentlich kritisiert werden sollte
Das Freemium-Modell ist ein Wachstumsgarant, weil es in neuen Märkten schnell ein Publikum an Spotify bindet. Das ist vor allem für die großen Musikkonzerne von Interesse, die auf der Plattform die größten Marktanteile haben und in ihrem Windschatten die Welt erobern können. Zwar sind auch sie davon betroffen, wenn die Einnahmen durch Streaming zu schrumpfen drohen. Deswegen sorgen sie für einen Ausgleich – und zwar für sich selbst. Die UMG war federführend bei den jüngeren Modifikationen der Ausschüttungsmodelle von Spotify und Deezer. Beide bedingen eine Umverteilung nach oben, weil weniger populäre Musik entweder direkt demonetarisiert oder aber weniger gewichtet wird, der "Kuchen" also für einige wenige vergrößert und alle anderen somit verkleinert wird.
So schaffen sich große Musikkonzerne wie UMG vorteilhaftere Bedingungen in unvorteilhaften Zeiten und hängen den Rest der Musikwelt immer weiter ab. Das ist per se nichts Neues, wurde das System Streaming doch überhaupt erst von den großen Musikkonzernen im Verbund mit Tech-Unternehmen wie Spotify errichtet. Der Branchenbeobachter Mark Mulligan bezeichnet deshalb konventionelle Streamingplattformen als "asymmetrische Modelle". Deshalb ist es irreführend, wann immer von "0,3 Cent pro Stream" die Rede ist: Es impliziert, dass dieser Betrag zu niedrig sei und die Lösung darin liege, ihn einfach anzuheben; als gäbe es einen Fehler im System, der nur behoben werden müsste. Dabei ist das System der eigentliche Fehler – zumindest für große Teile der Musikwelt.
Denn das System ist nicht "kaputt", sondern – auch davon zeugt Daniel Eks Investitionslust, finanziert mit fetten Erträgen aus seinen Spotify-Aktien – funktioniert wunderbar. Nur eben nicht für alle. Es wurde ja nur für einige wenige gebaut und wird, wenn überhaupt, nur zu ihrem Vorteil reformiert. Angesichts all dessen höhere Pro-Stream-Ausschüttungen zu fordern, ist nachgerade peinlich. Das Publikum dazu aufzurufen, lieber zu Qobuz, Deezer oder TIDAL zu wechseln, würde das Elend nur minimal verlagern. Auch der bisweilen geäußerte Wunsch nach einer Abkehr vom Pro-Rata-Modell wird sicherlich nicht erhört werden. Was es hingegen wirklich braucht, sind Optionen zum Status quo: neue Modelle, neue Plattformen – eine alternative Streamingökonomie.

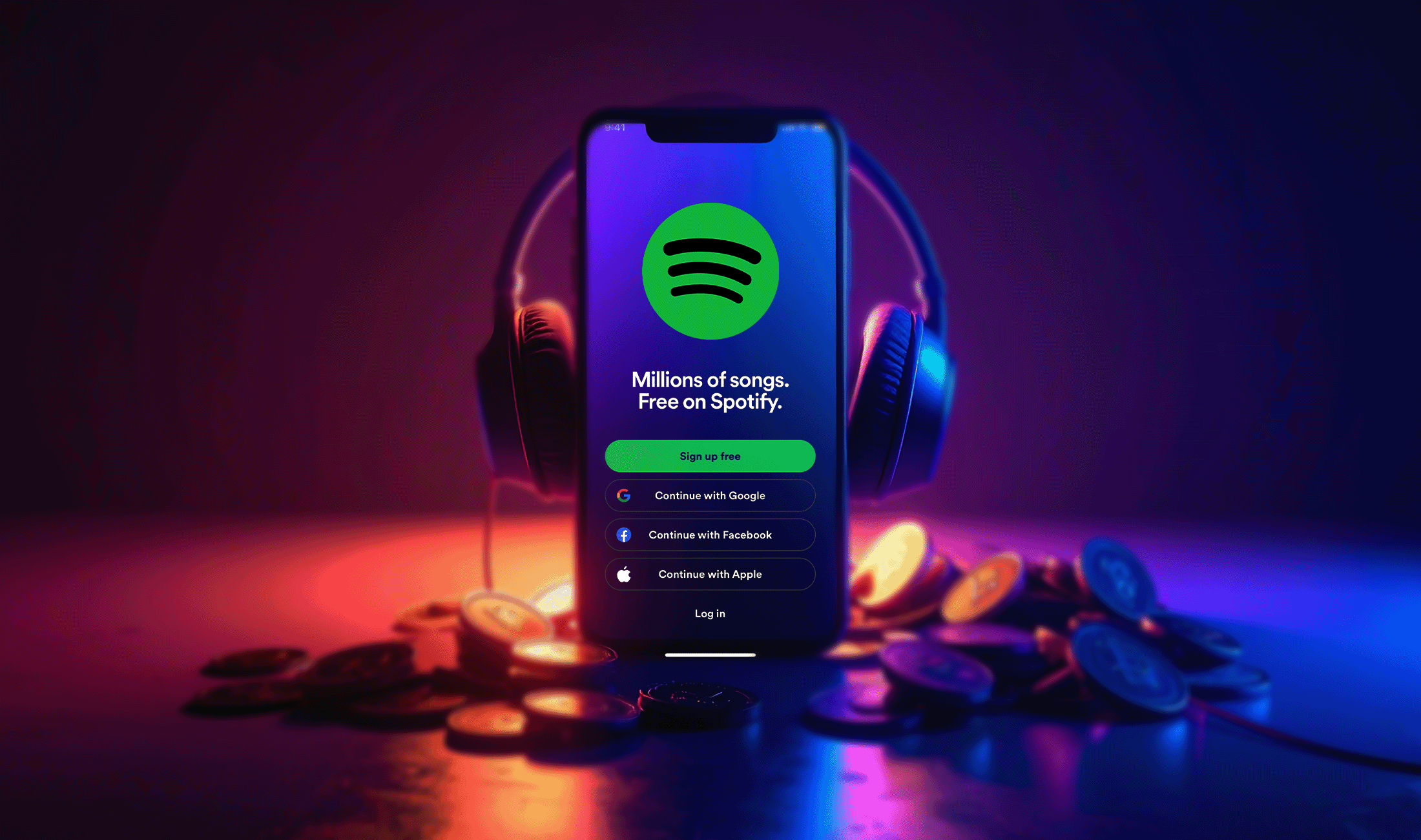



0 Kommentare zu "Zahlt Spotify "0,3 Cent pro Stream"? Nein!"