
Ungerechte Streaming-Wirtschaft: Was tun?
Big Tech und die Musikkonzerne bestimmen seit geraumer Zeit, wie das Streaminggeschäft läuft. Auch werden sukzessive andere Teile der Verwertungskette vom großen Geld aufgekauft. Das bietet für Indies und DIY-Artists Anlass zur Verzweiflung – und Chancen, kommentiert Kristoffer Cornils in der letzten Ausgabe der Kolumne Quartalsbericht: 2/2025.
Mehr als zwei Jahre lang habe ich im Rahmen dieser Kolumne versucht, im vierteljährlichen Turnus die hintergründigen Bewegungen der Musikindustrie und ihre Verflechtungen mit der Tech-Branche transparent und nachvollziehbar zu analysieren und zu kommentieren. Die zentrale, wenngleich nicht immer explizit geäußerte Leitfrage des Quartalsberichts lautete: Was bedeutet das für den Rest der Musikwelt? Wie betrifft es kurz- oder langfristig die Indie-Labels und -Artists, die trotz breiter Bündnisschlüsse bei Verhandlungen über die Vergütung von Musik meistens nicht mit am Tisch sitzen dürfen? Oder gar die vielen DIY-Künstler:innen, die kaum wahrgenommen werden und nicht entsprechend organisiert sind?
Angefangen mit der Einführung von "artist-centric"-Modellen bei Spotify und Deezer bis hin zum Run auf "Superfans" im Rahmen von "Streaming 2.0" haben die Entwicklungen der vergangenen zweieinhalb Jahre meiner Ansicht nach deutlich gezeigt, dass kleinere Labels und Künstler:innen im Streamingumfeld zunehmend marginalisiert werden. Die "artist-centric"-Modelle stellen entgegen ihrem Namen die Interessen der Major-Labels in den Fokus und stufen das meiste andere finanziell herab. Auch von "Streaming 2.0" können primär diejenigen verdienen, die bei den Labels von Konzernen wie der Universal Music Group (UMG) unter Vertrag stehen – deswegen begeben sich diese doch ja erst in "strategische Partnerschaften" mit Plattformen wie Spotify oder Amazon Music.
Konzerne wie Universal verstehen, dass dem Wachstum der Streamingwirtschaft auf Dauer Grenzen gesetzt sind. Deshalb schließen sie ja im Rahmen von "Streaming 2.0" umfangreichere Deals mit den Plattformen und versuchen zugleich, ihre Einnahmen aus allen anderen Teilen der Wertschöpfungskette im Geschäft mit der Musik auszuweiten. Nachdem UMG die Independent-Firma [PIAS] samt Vertriebsgeschäft aufkaufte, lancierte der größte der sogenannten Big Three über die zugehörige Virgin Music Group einen Kauf der Firma Downtown, zu der wiederum mit CD Baby ein großer Digitalvertrieb gehört. Immer mehr Großkapital besitzt und kontrolliert daher immer größere Teile der Infrastrukturen.
Selbst für auf eigene Faust aktive Künstler:innen wird es daher zunehmend schwieriger, nicht in irgendeiner Weise mit den Strukturen der ganz großen Konzerne in Berührung zu kommen und somit in indirekter Weise gesichtslose Großunternehmen mitzufinanzieren. Das schafft eine paradoxe Situation: Underground und Indie-Welt werden von der Musikindustrie zunehmend an den Rand gedrängt und sind doch enger mit ihr verflochten denn je. Zusätzlich sorgt die Flutung der Plattformen mit KI-Musik für höheren Konkurrenzdruck. Das schafft eine Atmosphäre der Verzweiflung, die sich – etwa durch Spotify-Features wie Discovery Mode oder Marquee – ausnutzen lässt. Von wegen "unabhängig"!
Das neue Zweiklassensystem
Wer das für eine eher düstere Interpretation der Gesamtsituation hält, mag sicherlich nicht Unrecht haben. Es deckt sich allerdings weitgehend mit den Ergebnissen eines von Dan Fowler und Katherine Bassett erstellten Berichts für IMPALA, der Dachorganisation für die Zusammenschlüsse von unabhängigen europäischen Independent-Firmen. Freilich spricht aus der Diagnose, es würde sich ein "two-tier music market" im Streamingbereich bilden, auch eine motivierte Dringlichkeit – IMPALA vertritt schließlich eben jene Akteur:innen, die von den kleinsten Gefällen am stärksten betroffen sind. Ein bisschen Alarmismus gehört da zum Kerngeschäft. Allerdings traut sich der Bericht nicht, direkt von einem Zweiklassensystem zu sprechen. Dabei schiene mir das gerechtfertigt.
Denn selbst der Chef des Marktforschungsunternehmens MIDiA Research Mark Mulligan, einer der führenden Analyst:innen der Musikwirtschaft und somit gewissermaßen ein überparteilicher und neutraler Beobachter, konstatiert Ähnliches. Er sieht die Musikwelt nach den diversen Veränderungen der jüngeren Zeit und angesichts des gedämpften Wachstums im Streaming an einem Scheidepunkt angekommen, wie er kürzlich auf seinem eigenen Blog schrieb. "Kurz gesagt: Wenn du groß bist, schaust du Großem entgegen, wenn du aber klein bist, wird der Pfad vor dir immer kleiner." Mulligan sieht für Indies und DIY-Artists keine rosige Zukunft, sollten sie so weitermachen wie zuvor und keine neue Richtung einschlagen.
Mulligan erinnert diese Teile der Musikwelt auch daran, dass sie dieser Weg sowieso nie in Richtung Erfolg führen sollte. Er spricht hinsichtlich der großen Streamingplattformen, deren Wirkweisen im Miteinander von den Musikkonzernen und Tech-Firmen – ob nun Spotify, Apple oder Deezer – festgelegt wurden, von "asymmetrischen Modellen". Denn sie wurden "nicht so gestaltet, dass die kleinen Akteur:innen gewinnen. Genau darum geht es doch." Deutlicher lässt es sich nicht ausdrücken: Streaming war immer schon immer eine Zweiklassenwirtschaft. Nur, was schlägt Mulligan vor? "Lediglich eine Art Indie-Spotify zu schaffen, wird nicht ausreichen", betont er immerhin.
Die große Weggabelung
Zum Verständnis von Mark Mulligans Empfehlungen für die kleinen Akteur:innen der Musikwelt ist ein Blick auf das zentrale Thema seines eigenen Unternehmens nötig. Die von MIDiA und Mulligan aufgestellte "bifurcation theory" besagt, dass sich die Musikwirtschaft in zweierlei Hinsicht an einer namensgebenden Weggabelung befindet. Dazu gehört zuerst, dass sich das Publikum zunehmend in zwei verschiedene Segmente mit unterschiedlichen Haltungen und Wirkungsstätten aufteile: Passive Konsument:innen lassen sich gerne ausschließlich von den Streamingdiensten beschallen, aktive Hörer:innen suchen darüber hinaus oder gar jenseits davon den direkten Austausch mit ihren Lieblings-Stars und bringen sich direkter über die Plattformen der sogenannten Creator Economy finanziell ein.
Diese Aufgliederung des Publikums hat ebenso seine historischen Vorläufer wie das neu(erlich)e Zweiklassensystem. Schon früher beherrschten die Musikkonzerne weite Teile der Vertriebsstrukturen und übten beispielsweise viel Einfluss auf das Radio aus. Und es gab Menschen, die nebenbei das Radio anwarfen, sonst aber herzlich wenig Geld für Musik ausgaben, derweil andere sich in Fanclubs organisierten und für Konzerte um die halbe Welt reisten. Mulligan und MIDiA stellen ihre These indes vor dem Hintergrund einer viel größeren Vernetztheit und Durchdringung von Musikwelt und Tech-Branche auf. Dieser Kontext verleiht den jüngeren Entwicklungen einen anderen Charakter: Alles wird immer mehr auf einige wenige Plattformen konzentriert, auf denen die zweite Klasse der Musikwelt immer mehr marginalisiert wird.
Vor diesem Hintergrund steht die zweite Implikation der "bifurcation theory" im Kern von Mulligans Blog-Eintrag: Die marginalisierten Teile der Musikwelt haben in der Regel die aktiveren Fans und könnten sich das in diesem historischen Moment zunutze machen. Anders formuliert will er den kleinen Akteur:innen dazu raten, sich von den konventionellen Streamingdiensten abzukehren und den Weg in Richtung eigener, passgenauer Plattformen einzuschlagen. Diese müssten grundlegend anders funktionieren als die auf die Bedürfnisse der Musikkonzerne ausgerichteten Vergütungsmodelle konventioneller Streamingplattformen, deren Angebot für ein passives Mainstream-Publikum optimiert ist. Wie aber sieht nun Mulligans Alternative konkret aus?
Mulligans Modell
Mulligan schwebt ein "kreditbasiertes System" vor, wie es von diversen Verkehrsbünden und Mobilfunkanbietern bekannt ist: Prepaid statt Flatrate. Statt einer monatlichen Abogebühr kaufen Nutzer:innen Credits und geben unterschiedlich viel von ihnen für bestimmte Streams aus, wobei die Bepreisung den Rechteinhaber:innen obliegen soll – null Credits für die deep cuts, drei für die Lead-Single, einer für reguläre Album-Tracks, oder so ähnlich. Das ist ein ehrbarer Ansatz – er zollt der Tatsache Tribut, dass eine 70-minütige elektroakustische Komposition, ein achtminütiger Techno-Track und eine 20-sekündige Grindcore-Explosion nicht einfach gleich berechnet werden können. Oder, wie im letzten Fall, nicht einmal monetarisierungsberechtigt sind, wie das bei Spotify und Co. gehandhabt wird. Der Wert von Musik würde so nicht von ihrer Laufzeit definiert.
Darin verbirgt sich also eine Geste der Selbstermächtigung. Die Komponistin, der Techno-Produzent und die Grindcore-Gruppe und/oder ihre Labels könnten in Mulligans Modell nunmehr festlegen, welchen Wert ein Stream ihres Stücks haben soll – beziehungsweise wie viel Geld sie damit verdienen wollen. Die Idee weist gewisse Parallelen mit dem stream2own-Prinzip von Resonate auf, in dessen Rahmen jeder neuerliche Play eines Musikstücks doppelt so viel kostete wie der vorige, bis der Preis eines durchschnittlichen Downloads erreicht war. Alle weiteren Plays waren dann kostenfrei. Das war in der Theorie attraktiv, weil Nutzer:innen den Wert der Musik bestimmen konnten.
Beiden Modellen ist jedoch gemein, dass sie die Streamingerfahrung in finanzieller Hinsicht für das Publikum potenziell unübersichtlich machen. Wie viel Geld habe ich nun verstreamt? Kann ich mir es leisten, jetzt gleich noch ein Album zu hören? Und wie höre ich Musik, wenn am Ende meines Kredits noch zu viel Monat übrig ist – nutze ich dann doch wieder mein Gratis-Abo bei Spotify oder YouTube? Mulligan mag sich bewusst sein, dass das von ihm in aller Prägnanz skizzierte Modell nicht sehr bequem wäre und sicher weiß er auch, dass Resonate – wohlgemerkt aus einer Vielzahl von Gründen – mit einem vergleichbaren Grundgedanken keinen Erfolg hatte. Womöglich würde er Musikfans gar dazu raten, das neue Angebot nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung zu konventionellen Services zu nutzen.
Der Fehler liegt anderswo. Denn schlägt Mulligan mit einem solchen Modell, das überdies noch menschlich-kuratierte Einrahmungen à la Apple Music 1 und redaktionelle Inhalte à la Bandcamp Daily enthalten soll, nicht doch das vor, wovon er eigentlich abraten will: ein Indie-Spotify? Eine Passepartout-Lösung, die als definitive Alternative für einen immer noch sehr breiten und heterogenen Teil der Musikwelt dienen soll?
Nicht eine, sondern viele Lösungen
Mark Mulligan versucht, den kleinen Akteur:innen angesichts des Zweiklassensystems neue Ideen einzuimpfen und damit Hoffnung zu wecken, wo aktuell noch eine Atmosphäre der Verzweiflung herrscht. Allein das ist wichtig. Wichtiger noch aber ist wohl, dass jede neue Idee nicht als Passepartout-Lösung, sondern nur als ein möglicher Ansatz von vielen begriffen wird. Der sich dezidiert an Fans von Rock und Metal richtende Dienst Rokk wäre wohl nach Mulligans Geschmack, auch SoundCloud ist als Indie-freundliche(re) Plattform zu nennen, die sich an sehr spezielle Zielgruppen richtet und deshalb mit einem anderen Ausschüttungsmodell experimentieren konnte. Eine genossenschaftlich betriebene Streaming- und Download-Plattform für Free-Jazz-Fans wie Catalytic Sound sollte auf sehr kleiner Ebene ebenfalls ein passendes Fallbeispiel für seine "bifurcation theory" liefern: von der Nische für die Nische.
Das genossenschaftlich organisierte Modell von Catalytic Sound stellt einen der Ansätze dar, die Liz Pelly in ihrem Buch Mood Machine. The Rise of Spotify and the Costs of the Perfect Playlist diskutiert. Die Journalistin warnt ebenfalls davor, bei der Suche nach Alternativen zu Spotify auf nur ein einziges Pferd zu setzen. Sie fordert stattdessen mehr Kreativität und Diversität. Auch öffentliche, von Bibliotheken geführte Streamingdienste sind für sie etwa denkbar. Die gibt es in Deutschland sogar, darauf ließe sich aufbauen. Und wieso eigentlich sollte der öffentlich-rechtliche Rundfunk hierzulande nicht auch zumindest bestimmte Titel und Playlists auf Abruf anbieten? Dort müsste dann nicht auf Basis von Play-Zahlen bezahlt werden. Wieso nicht stattdessen mit Lizenzverträgen arbeiten, wie sie aus dem Fernsehen bekannt sind – oder vom Streamingdienst Marine Snow ausprobiert wurden?
Wenn Mulligan für sein neues Streamingmodell auch "alternative Remuneration" fordert und dabei unter anderem "Shopify-ähnliche Artists-Stores" im Sinn hat, trägt er überdies der Tatsache Rechnung, dass vielen Musikfans das bloße Streaming sowieso nicht reicht. Die derzeit aus dem Boden sprießenden Bandcamp-Alternativen wie Ampwall, Mirlo und Subvert sollten deshalb ebenso in die Liste bereits existenter Alternativen aufgenommen werden, auch wenn Streaming bei ihnen soweit nur eine sehr untergeordnete Rolle spielt. Obwohl sich allemal fragen ließe, ob ein Vergütungsmodell für Streaming, wie bei AC55ID der Fall, in solchen Marketplaces integriert werden könnte. Vielleicht ja sogar in kreditbasierter Form. Das wäre, wie so viel anders, denkbar.
Nachdem diese Kolumne zwei Jahre lang die fortschreitende Konsolidierung des Streaminggeschäfts begleitet hat, endet sie mit dieser Ausgabe tatsächlich an einer Weggabelung. Doch gibt es nicht den einen Pfad, den die unteren Schichten des neu(erlich)en "two-tier music market" einschlagen sollten, sondern eine Vielzahl von möglichen Routen, denen unterschiedliche Akteur:innen folgen könnten, um für sich und mit den Angehörigen ihrer jeweiligen Subkulturen oder Interessengemeinschaften bessere Bedingungen zu schaffen – unter ihren eigenen Bedingungen. Denn was uns Initiativen wie Mirlo, Subvert oder der sich ebenfalls im Aufbau befindliche, genossenschaftlich betriebene Streamingdienst Tone lehren können: Die Musikwelt ist nicht auf die Tech-Branche angewiesen, sie kann ihre eigenen Plattformen aufbauen.
Das würde freilich viel Arbeit mit sich bringen und natürlich stellt sich die Frage, wohin jede der möglichen Reisen führen könnte. Sicher ist an diesem Punkt lediglich eines: All die wirtschaftlich marginalisierten, verschiedentlich von den Musikkonzernen und Tech-Plattformen abhängigen kleinen Akteur:innen haben herzlich wenig zu verlieren. Denn das System war nie für sie gemacht und zeigt ihnen das nun mit voller Brutalität. Weitergehen wie zuvor kann es also auf gar keinen Fall.
Was sonst noch wichtig war:
Berlins Kultursenator Joe Chialo hat hingeworfen, nachdem er doch nicht – wie zuvor fälschlicherweise gemeldet – zum Kulturstaatsminister ernannt wurde (s. u.). Angeblich aber ging es ihm nicht etwa um ein gekränktes Ego und die Aussicht, dass seine politische Karriere vorbei ist. Vielmehr behauptete er, die Haushaltskürzungen nicht mehr tragbar zu finden. Schon verständlich, seine eigene Partei hatte ihn dabei ja nicht einmal mitreden lassen. Seinen Job übernimmt nun die parteilose Kulturmanagerin Sarah Wedl-Wilson.
Beyerdynamic wurde vom chinesischen Gerätehersteller Cosonic Intelligent Technologies übernommen. Die Konsolidierung des Hardware-Markts schreitet unablässig voran.
Die Create Music Group kündigte direkt nach dem Tod von Horst Weidenmüller an, dessen Firma !K7 übernommen zu haben. Der US-amerikanische Musikverlag und Vertrieb hatte damit offensichtlich noch nicht genug und akquirierte nur kurz darauf das kanadische EDM-Label Monstercat. Auch das Vertriebs- und Label-Geschäft im Indie-Bereich wird somit von immer weniger Parteien kontrolliert.
Deezer meldete noch im Januar, dass täglich 10.000 vollständig mittels KI generierte Musikstücke auf den französischen Streamingdienst geladen würden. Kaum drei Monate später waren es dann schon 20.000. Wohlgemerkt könnte die Dunkelziffer noch wesentlich höher sein und werden all diese Stücke vermutlich ebenso an die meisten anderen Services ausgeliefert beziehungsweise sind dort erhältlich. Deezer demonetarisiert oder löscht den KI-Slop zwar nicht, nimmt aber eindeutig identifizierte Stücke nicht mehr in redaktionelle und algorithmische Playlists auf. Seit Kurzem werden sie auch für das Publikum deutlich als KI-generiert markiert. Auch das scheint begrüßenswert, schafft es doch mehr Transparenz. Reine Eigeninitiative? Vielleicht nicht, der AI Act der Europäischen Union sieht doch eigentlich Vergleichbares vor.
DICE hatte quasi gerade eben erst Boiler Room abgestoßen, geholfen hat es dem wirtschaftlich schiffbrüchigen Ticketing-Unternehmen aber wohl nicht: Die Plattform wurde von Fever aufgekauft, einer Empfehlungsplattform für Musikveranstaltungen, die DICE wohl nun ins Angebot integrieren wird. Na, Glück auf.
Epidemic Sound wird den meisten Menschen als die Produktionsfirma bekannt sein, die Spotify mit "perfect fit content" beziehungsweise mit der Musik von heiß diskutierten "fake artists" belieferte. Im Interview mit Murray Stassen von Music Business Worldwide prahlte Chef Oscar Höglund nun mit gestiegenen Umsätzen und der großen Sichtbarkeit (von Hörbarkeit kann ja nicht die Rede sein) der Produkte seines Unternehmens. Epidemic Sound hat auch einen neuen Service zum Erkennen von Musik in nutzergenerierten Videos in Social Media ausgerollt – eine Art B2B-Shazam, das eine bessere Tantiemenverteilung garantieren soll.
Die Festivalkrise hält weiter an, wobei differenziert werden muss: Von steigendem Kostendruck und ausbleibendem Publikum sowie anderen Hürden sind vor allem die kleinen und mittelgroßen Festivals betroffen. In einem Interview mit mir für einen DLF-Kultur-Beitrag gab LiveKomm-Geschäftsführer Christian Ordon an, dass dieses Jahr gut ein Dutzend Festivals nach diesem Jahr nicht mehr stattfinden könnten. Sein Verband sieht ausgehend von einer Mitgliederumfrage kleine Bühnen insgesamt "mit dem Rücken zur Wand". Der Verzwicktheit der derzeitigen Situation des Live-Geschäfts widmete Daniel Nagel einen Beitrag für Backstage PRO, ebendort gab sich Michael Erle etwas lebensbejahender: Er zeichnete die wichtigsten Bedingungen für ein gelingendes Festival nach. Fünfter und letzter Punkt: "Gutes Wetter". Hm.
Die GEMA zumindest hat es wieder regnen lassen. 1,1 Milliarden Euro schüttete die Verwertungsgesellschaft für das Geschäftsjahr 2024 aus. Weil die Sachlage eben komplex bis paradox ist, kommt viel von diesem Geld aus dem Veranstaltungsbereich. Nicht ganz so erfolgreich lief – je nach Perspektive – die Abstimmung über eine Reform der weiterhin geltenden Unterscheidung in E- und U-Musik: Bei einer Mitgliederversammlung wurde die notwendige Zweidrittelmehrheit zu ihrer Reform nicht erreicht. Von außen betrachtet mag der Widerstand gegen eine überholte Aufgliederung in vermeintlich "ernste" und angeblich nur der "Unterhaltung" dienende Musikformen sinnfrei sein, für viele Komponist:innen komplexerer und damit zeitintensiverer Werke ist sie aber sehr wichtig. Jetzt ist wohl die Zeit für den Dialog gekommen, im nächsten Jahr könnte erneut abgestimmt werden.
KKR ist eine Investmentfirma mit zwielichtigem Portfolio, zu dem seit einer Weile auch der Großveranstalter Superstruct gehört. Dem wiederum gehört seit Kurzem Boiler Room sowie schon länger die Festivals Field Day in London und das Sónar in Barcelona. An letztere richteten sich Kritik sowie Boykottaufrufe, weil sie nunmehr indirekt an ein Unternehmen mit mehr als dubiosen Machenschaften angeschlossen sind. Hat’s KKR geschadet? Eine per Privatverbriefung des Musiktantiemen-Portfolios getätigte Investition über 500 Millionen US-Dollar in die Private-Equity-Firma HarbourView lässt Gegenteiliges vermuten. Um Jodi Dean zu paraphrasieren: KKR doesn’t care if you cancel DJ gigs.
Der Koalitionsvertrag enthält einen Satz zur Clubkultur. Das kennen wir bereits aus dem Koalitionsvertrag der Ampel, beim DLF Kompressor habe ich das (Non-)Update mit literaturwissenschaftlicher Strenge auseinandergenommen. Fazit: Kann vieles heißen, muss gar nichts bedeuten. Die LiveKomm mahnt in einem Statement bei der Umsetzung des erneuten Lippenbekenntnisses "zur Eile".
Der neue Kulturstaatsminister, in dessen Aufgabenbereich dergleichen fällt, heißt übrigens Wolfram (nicht: Wolfgang) Weimer. Nie gehört? Kein Wunder, der Mann kommt aus der Verlagsbranche beziehungsweise dem Journalismus und hat keinerlei politische oder kulturbetriebliche Erfahrungen, dafür aber einen Backkatalog von extrem kulturkonservativen Büchern vorzuweisen. Der ihm zur Verfügung gestellte Haushalt soll allerdings auf 2,25 Milliarden Euro aufgestockt werden, es läuft wohl zumindest auf einen Inflationsausgleich hinaus. Geld soll vor allem in Bauprojekte gesteckt werden. Was das heißen wird: bisher unklar. Der Bundestag muss sowieso noch grünes Licht für den Haushaltsentwurf geben.
Künstliche Intelligenz bleibt für die Musikindustrie Problem und Potenzial zugleich. Laut eines Experiments eines Redakteurs der MIT Technology Review erkennen selbst Tech-Profis KI-generierte Musik nur schlecht als solche, was natürlich diversen Betrugsmaschen Aufwind gibt. Mehr Transparenz wie bei Deezer (s. o.) beziehungsweise vom europäischen AI Act vorgesehen ist also dringend notwendig. Nicht wenige Akteur:innen der Musikwelt zeigen sich laut einer Billboard-Recherche von Richard Smirke über letzteren besorgt, weil die versprochene Transparenz eventuell doch nicht gegeben sein könnte. Den ganz großen Playern ist das sowieso egal: Die Big Three befinden sich derzeit mit Suno und Udio in Lizenzierungsgesprächen, um an der Nummer mitzuverdienen. Die Indies sitzen natürlich nicht mit am Tisch, weshalb nun in den USA die erste Sammelklage an den Start ging. Der Claude-Anbieter Anthropic vertraut übrigens dermaßen auf KI, dass diese selbst vor Gericht zum Einsatz kam – und natürlich wild halluzinierte. Dasselbe Unternehmen konnte allerdings durchboxen, dass das Training an urheberrechtlich geschützten Büchern als "Fair Use" durchgeht. Für die Musikwelt jedoch muss das nicht unbedingt etwas heißen, erklärt Daniel Tencer bei Music Business Worldwide. Tatsächlich wurde in einem anderen Gerichtsurteil – hier wurde gegen Meta geklagt – dem Ganzen per se widersprochen. Es bleibt, äh, spannend.
Sennheiser muss eine Kartellstrafe in Höhe von sechs Millionen Euro zahlen. Das Bundeskartellamt hatte dem Kopfhörerhersteller illegale Preisabsprachen vorgeworfen.
SoundCloud hat sich, es lässt sich kaum anders sagen, ein bisschen eingeschissen. Ein Update der Nutzungsbedingungen im Februar 2024 implizierte, dass alle Uploads zum Training für KI-Programme freigegeben wären. Die Berliner Firma bemühte sich sehr schnell, zu erklären, dass der entsprechende Passus sich nur auf den Kontakt mit KI-Technologie wie Empfehlungsprogrammen auf der Plattform bezöge und SoundCloud "nie künstlerische Inhalte verwendet hat, um KI-Modelle zu trainieren, noch KI-Tools entwickelt oder Dritten erlaubt hat, SoundCloud-Inhalte für KI-Trainingszwecke zu verwenden oder zu scrapen." Na dann.
Splice hat Spitfire übernommen und in dem Rahmen etwas von "ethischen KI-assistierten Werkzeugen" gebrabbelt. Na klar. Kurz darauf hat Splice eine Kollaboration mit Pro Tools angekündigt.
Spotify hat die Abopreise in Benelux und kurz darauf in Frankreich angehoben, weshalb ein neuerlicher Anstieg in Deutschland wohl bald ins Haus steht. Im ersten Quartal machte Daniel Eks Firma einen Umsatz von satten 4,5 Milliarden US-Dollar. Unter anderem deshalb kann es sich der Chef auch leisten, noch ein bisschen mehr Kohle in Militärtechnologie zu investieren. Der Mann hält es also ähnlich wie KKR (s. o.).


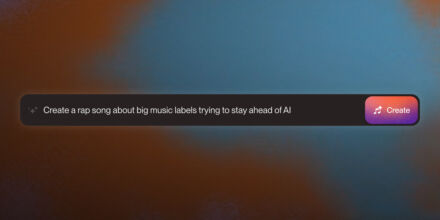


0 Kommentare zu "Ungerechte Streaming-Wirtschaft: Was tun?"