Wer sagt eigentlich, was ein:e erfolgreiche:r DJ ist? DJs mit den meisten Followern? Die mit der höchsten Gage? Oder vielleicht doch jemand, dessen Set um fünf Uhr früh dafür sorgt, dass ein Raum kollektiv weint, obwohl niemand weiß warum? Erfolg in der elektronischen Musik ist ein Chamäleon: mal Chartplatzierung, mal Kellerruhm, mal Stadiontour, mal 300 Menschen, die illegal im Industriegebäude ihre Soundboks aufstellen.
Fangen wir dennoch dort an, wo alle guten Dinge beginnen: in den Neunzigern. Da waren "erfolgreiche DJs” ein völlig anderes Konzept. Erfolg hieß nämlich nicht: Millionen Streams, Pyro auf der Bühne oder ein Interview mit GQ. Erfolg bedeutete: Du warst mal in Frankfurt im XS oder in Berlin im E-Werk zur richtigen Zeit. Du hattest ein White Label auf Tresor, das Jeff Mills ins Set genommen hat. Oder du warst einfach die Person, die genug Pillen hatte, um den Sonntag zu retten.
Auch interessant

Heute heißt Erfolg oft: Du hast einen Song mit Dua Lipa und einen Energy-Drink-Deal. Dazwischen liegt nicht nur Spotify, sondern auch der Verlust von Chaos, Mystik und, jaha: Bedeutung. Denn früher, ja früüüher, da ging es für DJs weniger um Reichweite, mehr um Reichhaltigkeit. Wer ein gutes Set spielen konnte, ohne dabei auszusehen, als würde er eine Steuererklärung eintippen, war schon mal klar im Vorteil.
Und die DJs, die obendrein noch wussten, wie man das Filter auf dem Xone:62 bedient, galt in der Techno-Szene als echter Virtuose. Erfolg war nämlich etwas, das sich in verschwitzten Kellern entschied, nicht in YouTube-Kommentaren. Die wichtigsten Karrieren starteten im Halbdunkel. Wortlos. Auf Plattentellern.
Pogen mit Populismus
In dieser Zeit galten Leute wie Sven Väth, WestBam oder Tanith nicht nur als DJs, sondern als kulturelle Koordinaten. Väth, der kauende Dionysos, machte sich mit Eye Q und später Cocoon zur Marke, lange bevor Techno zur Ware wurde. WestBam wiederum konnte die große Geste, das politische Pathos und die Pogo-Rhetorik; sein Erfolg war eine Mischung aus Ravepopulismus und intellektuellem Bruchliniengezwitscher. Tanith trug dagegen Tarnhose und Turntables in den Club wie andere das Evangelium in die Kirche und sprach dazu Techno mit Berliner Dialekt.
Und ja. Damals reichte es, für die meisten DJs auf einem Flyer zu stehen. Heute braucht man mindestens dreizehntausend Follower. Früher war es eine Ehre, um 6 Uhr früh im Bunker aufzulegen. Heute ist es die Möbelkollektion im Einrichtungshaus. Und trotzdem: Der Begriff "erfolgreicher DJ” ist nicht einfach gekippt, sondern hat sich gefaltet, geklont und aufgesplittet wie ein Breakbeat. Denn natürlich gibt es sie auch heute. Die, die beides können: Club und Mainstage. Tresor und TikTok. Underground und Upgrade in die Business Class.
Nehmen wir Charlotte de Witte. Wäre sie in den Neunzigern unterwegs gewesen, hätte sie wohl in Brüssel Demos gegen das Königshaus organisiert, um danach ein 140-BPM-Live-Set in einem besetzten Parkhaus zu spielen. Heute ist sie das Gesicht eines Techno-Brandings, das "Underground” in Gucci schneidert und an Eventagenturen verkauft. Ihre Kickdrums pumpen auf jeder Festivalbühne, aber ihr Habitus bleibt Club-kompatibel. Ähnlich bei Peggy Gou: Sie hat aus dem Hauch von House ein weltweites Lifestyle-Imperium gebaut. Musik, Merch, Mode – das Ganze in der Ästhetik eines schicken Wartezimmermagazins für Synthesizer-affine Influencer.
Oder Ben Böhmer: Der Typ klingt, als hätte man Moderat in ein Thermalbad geschickt. Und trotzdem verkauft er weltweit Hallen aus, wird gestreamt wie Ed Sheeran auf MDMA und bleibt dabei so unfassbar unauffällig, dass man ihn problemlos bei einem Familienessen mit der Schwiegermutter vorstellen könnte. Erfolg im Jahr 2025 heißt nämlich auch: Man ist nie negativ aufgefallen. Man ist Booking-safe.
Helden im Halbdunkel
Aber auch das andere Ende des Spektrums liefert. DJ Hell zum Beispiel. Der trägt heute noch Lederjacke und Attitüde wie andere einen Turnbeutel. Einer, der Techno nie als musikalische Form, sondern als soziokulturelles Statement verstanden hat. Hell war Electroclash, bevor irgendwer wusste, wie man das schreibt. Und als Deutschland noch zu RTL2-Beats feierte, legte er Soundtracks für Modeschauen auf; oder für sexpositive Partys mit Nivea-Rasierschaum.
Und natürlich: Carl Cox. Der einzige Mann, bei dem es glaubwürdig wirkt, wenn er zum dritten Mal in Folge ruft: "Oh yes, oh yes!” In den Neunzigern ein Partybulle mit drei Plattenspielern. Heute ein DJ-Diplomat, der auf Ibiza ein Dauerabonnement für gute Laune hat. Cox ist die Brücke zwischen damals und heute, zwischen Bunker und Bühne.

Dass Erfolg im DJ-Kosmos nicht mehr an Plattentaschen, sondern an Paketlieferungen von Techniker:innen gemessen wird, zeigt sich auch bei deutschen Acts der Jetztzeit. Reinier Zonneveld, obwohl Holländer, sei hier mal als Beispiel genannt, weil er das Prinzip auf die Spitze treibt: Live-Set, Acid, Rave-Ästhetik – aber in einem Setup, das aussieht wie die Stage von Rammstein ohne Feuer.
S steht für Spektakel
In Deutschland selbst hat sich derweil ein Paralleluniversum gebildet, in dem Techno immer noch aussieht wie 1996, nur mit besserer Deko und veganerem Backstage. Acts wie Kobosil oder Klangkuenster bauen auf Panzerschokoladenkrach und martialische Mienen. Berlin bleibt ein Schmelztiegel, aber der Beton hat jetzt einen Instagram-Account. Zwischen Selbstinszenierung und Sample-Scham, zwischen Funktion One und Function Wear.
Die Mainstage wiederum ist längst ein Paralleluniversum geworden. Auf ihr spielt EDM-DJ %sitename%s, der so klingt, als hätte H.P. Baxxter einen Tropfen Techno in seinen Champagner geschüttet. Es geht nicht mehr um Plattensammlung, sondern um Produktplatzierung. Um explosive Drops und durchgecastete Tracklists. Hier werden keine musikalischen Geschichten erzählt, hier wird eskaliert. Für das Handyvideo. Vielleicht auch für den Moment.
Die erfolgreichsten DJs auf diesen Bühnen heißen nicht mehr Jeff Mills oder Ellen Allien, sondern Martin Garrix, Marshmello oder Timmy Trumpet. Letzterer spielt nicht nur Musik, sondern Blasinstrumente – live, auf einer Festivalbühne, begleitet von CO2-Kanonen. Wenn das kein Erfolg ist, was dann?
Und doch: Die Grenzen verschwimmen. Auch Underground-DJs sind heute längst Agenturprodukte. Auch in Berghain-Sets finden sich dramaturgisch platzierte Crowd-Pleaser. Auch bei Boiler Room spielt längst nicht mehr jeder, der es musikalisch verdient hätte. Sondern der, der gut aussieht oder seine Socials löscht, bevor es die Socials tun.
Erfolg ist Erfolg
Andere atmen einmal tief durch und machen das Durchziehen zur Corporate Identity. FJAAK zum Beispiel. Irgendwo zwischen Industrial, Modekampagne und DIY-Etikett, spielen sie Live-Sets mit Maschinen, die aussehen, als hätte jemand ein sowjetisches Flugzeugcockpit ausgeschlachtet. Trotzdem werden sie beim Coachella gebucht. Und auch sie posieren für Werbekampagnen, wenn die Gage stimmt.
Und ja, da ist noch Dixon. Der ewige Verweigerer. Einer, der Techno wie ein Weinsommelier serviert. Sein Label Innervisions steht für Soundästhetik und Booking-Purismus – und ist gleichzeitig ein globales Premiumprodukt, das von Tulum bis Tokio verkauft wird, weil hey, das ist Underground als Luxus.
Nicht zu vergessen: Helena Hauff, Hamburgs finsterste Frohnatur. Sie spielt Sets, als würde sie mit einem Schraubenzieher im Stromkasten tanzen. Dabei bedient sie weniger den Instagram-Overkill. Sie spart sich die großen Worte eher ganz. Im Gegenzug schreiben begnadete Feuilletonisten irgendwas von "kompromisslosem Sound”, weil: Bei ihr wirkt Techno wieder wie eine musikalische Drohgebärde. In diesen Zeiten fast schon ein politisches Statement.
So wird das auch Rene Wise unterschreiben. Der Schweigsame. Der Arivierte. Er ist einer dieser DJs, die keine große Show abziehen, nicht die Arme hochreißen. Er ist einfach einer der DJs, bei dem sich Sound und Silhouette auflösen. Manche schreiben Doktorarbeiten über seine Klubnachtclosings. Und das ist vielleicht die höchste Form von Erfolg: Wiedererkennbarkeit ohne Markenbildung.
Das bringt uns zum Anfang zurück. Was ist eigentlich ein:e erfolgreiche:r DJ? Wahrscheinlich niemand, der auf den tollen Listen steht. Erfolg ist hier eher: ein Zustand, eine Pose. Zwischen Airline-Meilen und Afterhour, zwischen Funktionalität und Folklore. Wo die einen spielen, um zu fliegen, fliegen die anderen, um zu spielen. Und manche machen manchmal beides. Mit einem Lächeln, das genauso gut ehrlich wie gesponsert sein kann.

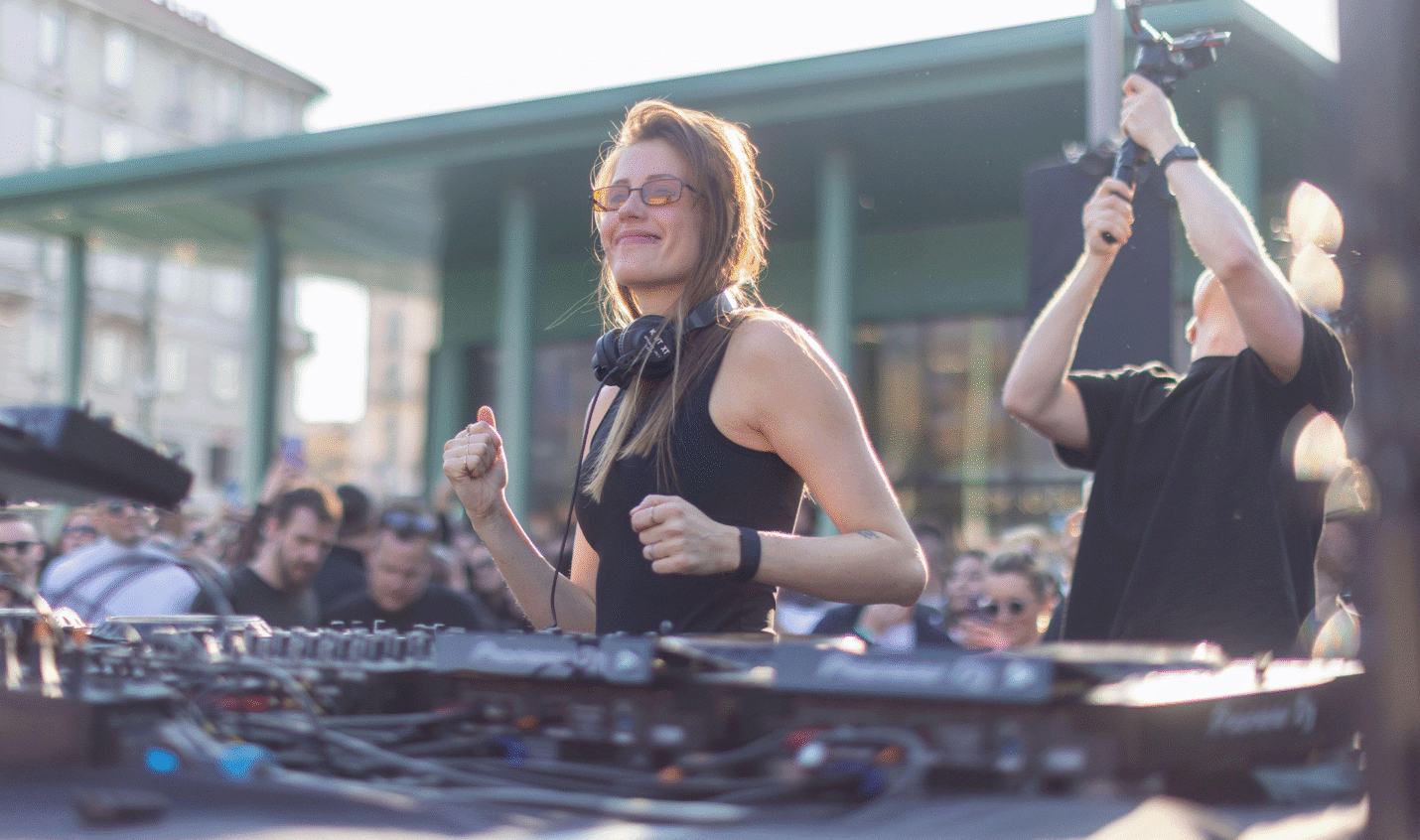


0 Kommentare zu "Bruchstelle: Wer sind die erfolgreichsten DJs?"